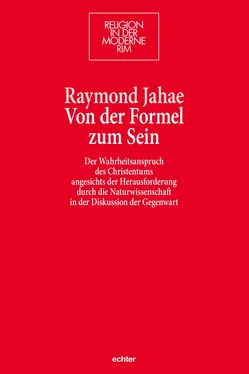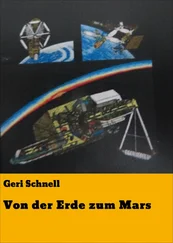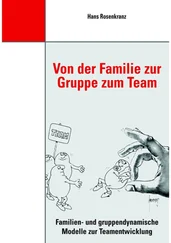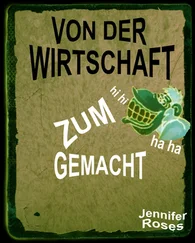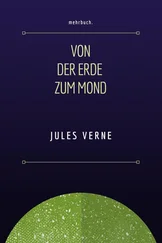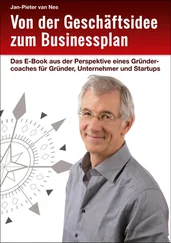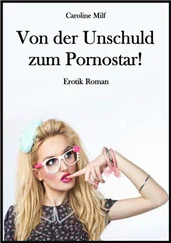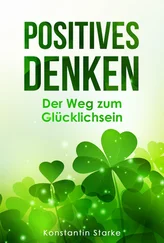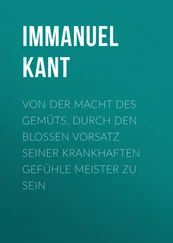59Siehe OVERHAGE/RAHNER, Problem, S. 55-78.
60Siehe GESCHE, Dieu I, S. 15-44.
61Die zweite Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, das Wort, hat menschliches Fleisch angenommen in Jesu von Nazareth. In Ihm ist das Wort Mensch geworden. Aus verschiedenen Gründen aber kann selbst der Mensch Jesus nicht einfach mit Gott identifiziert werden. Erstens ist das in Jesu fleischgewordene Wort in uneingeschränktem Sinne der Träger der göttlichen Natur, aber trotz der vollkommenen Einheit der göttlichen Personen erschöpft sich die Allerheiligste Dreifaltigkeit nicht in der zweiten Person, der Person des Wortes oder des Sohnes (vgl. z.B. Mt. 11,25-27). Zweitens fällt das Wort nicht zusammen mit der historischen Gestalt Jesu von Nazareth. Denn das Wort ist vor der Fleischwerdung, und trotz der Einheit zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur im fleischgewordenen Wort wird der Unterschied zwischen den Naturen durch die Inkarnation nicht aufgelöst. – Es dürfte besser sein, zu sagen, daß in Jesu Gott – genauer: die zweite Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit – die menschliche Natur angenommen hat, als zu sagen, daß der Mensch Jesus Gott ist. Denn letzterer Ausdruck könnte suggerieren, daß das Menschsein Jesu Seine Göttlichkeit trägt und umfaßt, aber nach der doktrinären und theologischen Tradition der Kirche ist es die Person des Wortes, die die zwei Naturen des Gottmenschen trägt. Logisch und ontologisch wird man der Tradition zustimmen müssen; die Vorstellung, daß ein Mensch aus sich selbst heraus in der Lage wäre, die göttliche Natur zu tragen, ist logisch und ontologisch absurd und widerspricht der hl. Schrift.
62Siehe GRESHAKE, Freiheit, S. 41-44; ID., Erlöst, S. 13-17.
63Siehe das Zitat bei LOHFINK, Gemeinde, S. 212. Eine ähnliche Haltung dürfte sich beim mittlerweile seliggesprochenen Kardinal J.H. Newman (1801-1890) finden (vgl. HONORE, Pensée, S. 34-36).
64„Die Evangelien stimmen […] überein in der Überlieferung des ‚freundschaftlichen‘, ‚versöhnten‘, ‚harmonischen‘ Verhältnisses Jesu zur Welt. Die Außenwelt wird von ihm angenommen als vom Vater geschaffene Wirklichkeit, außerordentlich reich an göttlichen Gaben, die der Mensch mit klaren und selbstlosen Augen betrachten und in ihrem Reichtum und ihrer Majestät bewundern soll (cf. Mt. 6,28-31; Lk. 12,22-31). Die Wirklichkeit der Natur wird von ihm mit Sympathie beobachtet als Geschöpf des Vaters, Ort, Mittel und Zeichen der Brüderlichkeit und des Teilens unter den Menschen“ (FISICHELLA/IAMMARRONE, Salvi, S. 24).
65Siehe SCHULTE, Wirken, S. 131-135. Zum Problem der „natürlichen“ Gotteserkenntnis im hier zitierten Abschnitt, siehe DUBARLE, Manifestation, S. 201-235.
66Siehe MINNERATH, Sens , S. 22-23.
67Nach WANSBROUGH, Use, S. 84, kämpfte der hl. Bernhard von Clairvaux „gegen die zu seiner Zeit von Abélard vertretenen entstehenden intellektuellen Bewegungen logischer und wissenschaftlicher Forschung“, „weil er sie für unwichtig für die Suche nach Gott hielt“.
68Siehe DIJKSTERHUIS, Mechanisering, S. 99.
69Auch in der Moderne wurde die Naturphilosophie (als unterschieden von der Naturwissenschaft im Stile Galileis und Newtons) oft a priori entwickelt. Es wäre hier etwa an Kants Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft zu denken.
70Siehe die Darstellung der fünf „Wege“ des hl. Thomas zu Gott bei ELDERS, Metafysica II, S. 134-217. Der Ausgangspunkt jedes „Weges“ ist eine Gegebenheit der Erfahrung ( ibid., S. 202). Für den fünften „Weg“ ist es die Tatsache von Finalität und Ordnung in der Natur.
71Für die „christliche Bedeutung der Säkularisierung“, siehe COTTIER, Questions, S. 79-106.
72Siehe DIJKSTERHUIS, Mechanisering, S. 275-276, 297-298; COYNE/HELLER, Comprehensible, S. 79-81. Auch Galileis Werk war maßgeblich von der Entwicklung der Technik, namentlich Schiffsbau und Schußwaffen, inspiriert. Siehe dazu BÜTTNER/RENN, Kosmologie, S. 55-59.
73Die Verflechtung von Entwicklung der Technik und Streben nach Wissen um des Wissens willen als treibende Kraft hinter der Entwicklung der Physik zeigt das Beispiel der speziellen Relativitätstheorie. „Auch die Relativitätstheorie, die theoretische Grundlage der modernen Kosmologie, verdankt ihre Entstehung nicht zuletzt den epistemischen Herausforderungen neuer Technologien, mit denen schon der junge Einstein in der elterlichen elektrotechnischen Fabrik konfrontiert war. Die neuen Raum- und Zeitbegriffe, die Einsteins spezielle Relativitätstheorie von 1905 einführt, sind in der Tat das Resultat seiner Versuche, Probleme der Elektrodynamik bewegter Körper zu lösen. Solche Probleme stellen sich dort, wo mechanische Bewegung und elektromagnetische Phänomene zusammentreffen, wie z.B. beim Dynamo oder bei der spekulativen Frage, ob man etwa einen Lichtstrahl überholen kann – wie sie sich schon der junge Einstein stellte“ (BÜTTNER/RENN, Kosmologie, S. 69-70).
74Siehe VAN MELSEN, Natuurwetenschap, S. 29-39.
75Das Evangelium von Jesu Leben, Tod und Auferstehung nimmt die Zerbrechlichkeit des irdischen Lebens ernst, öffnet aber zugleich eine Perspektive auf Leben über den Tod hinaus, d.h. auf transzendentes Heil.
76Das widerspricht nicht dem, was wir vorher über die Implikationen des Schöpfungsglaubens sagten (siehe oben, S. 59-61). Das nach Gen. 1 mit der Schöpfung gegebene Gebot, das auch das Gebot, die Welt zu erforschen, ist, wird gegeben an einen Menschen, der sich findet in einer Welt, in die das Übel noch nicht hereingebrochen ist und die somit noch nichts Beängstigendes hat, vielmehr dem Menschen als geordnet erscheint. Weiter ist zu bemerken, daß Gen. 1,1-2,4 auch dazu dient, dem jüdischen Volke, das in turbulenten Zeiten lebt und ihm unverständliche Leiden – den Fall Jerusalems und das Exil in Babylonien – erdulden muß, Hoffnung zu schenken, indem dem Volke gezeigt wird, daß Gott die Fäden von Gelingen und Leiden in Seinen Händen hält.
77Nach S. Breton war es jedoch „notwendig“, daß die moderne Naturwissenschaft im Sinne eines quantitativen deterministischen Naturverständnisses nach „Naturgesetzen“ entstand, weil ein Naturverständnis, das bei den Qualitäten stehenbleibt, nichts erklärt und die Freiheit nur in einer Natur wie die moderne Naturwissenschaft sie versteht, sich verwirklichen bzw. bestehen kann. Siehe dazu BRETON/DUBARLE/COSTA DE BEAUREGARD/LATOUR, Idée, S. 52-71.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.