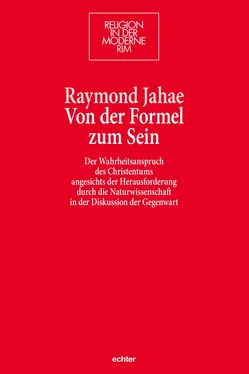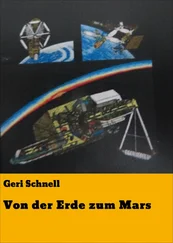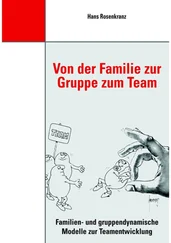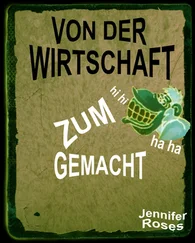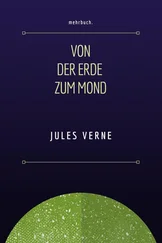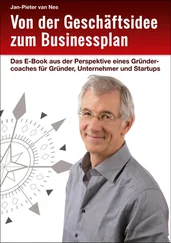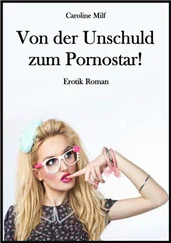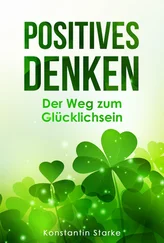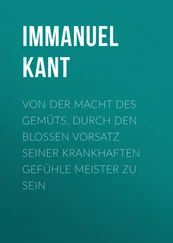Diese spätmittelalterlichen Entwicklungen mögen die Geburt der modernen Naturwissenschaft – im Sinne Galileis und Newtons – begünstigt haben, es ist nichtsdestoweniger so, daß das Erscheinen der modernen Wissenschaft etwas Neues in der Kulturgeschichte Europas darstellt. Kennzeichnend für die moderne Naturwissenschaft ist nicht nur ihr empirischer, experimenteller Charakter, sondern auch ihr Interesse für das, was die griechische Philosophie oft als „akzidentell“ betrachtete, besonders das Phänomen der Bewegung (Ortsveränderung), und ihre erklärte Absicht, diese akzidentelle Wirklichkeit mathematisch zu beschreiben. Es gibt nur wenige Präzedenzien hierfür im vormodernen Denken. Weder das Interesse fürs Akzidentelle im allgemeinen und für Ortsveränderung im besonderen, noch die Absicht, es mathematisch zu beschreiben, fehlte im griechischen Denken, aber wie wir bereits sahen, widmete dieses seine Aufmerksamkeit doch hauptsächlich dem Bleibenden, dem Sein im Blick auf das, was für die menschliche Existenz wesentlich ist, und beschrieb es in der dem Qualitativen angemessenen Sprache. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das antike und mittelalterliche christliche Denken kaum vom antiken griechischen. Trotz des Platzes, der im Spätmittelalter geschaffen wird für die Erforschung des eigenen Sinnes der „natürlichen Ordnung“, unabhängig von ihrer Bedeutung für die Beziehung zu Gott, bleibt für das Christentum die Gemeinschaft mit Gott bzw. die selige Gottesschau die wahre Bestimmung des Menschen, und beim Erreichen dieser Bestimmung kommt der Erforschung der Natur keine wesentliche Rolle zu.
Aristoteles’ irrige Ansichten über die Bewegung fliegender und fallender Körper blieben im wesentlichen unumstritten bis zum Ende des Mittelalters. Es war hauptsächlich das Bedürfnis nach akkuratem Waffenzeug, also die Entwicklung der Technologie, die dazu führte, daß diese Ansichten als falsch entlarvt und korrigiert wurden 72. Ihre Berichtigung erforderte die Arbeit mehrerer Forschergenerationen und wurde von Galilei besiegelt. Auch auf anderen Gebieten der Naturwissenschaft war es oft durch die Entwicklung der Technologie oder den Willen, das was heute „Lebensqualität“ genannt wird, zu verbessern, nämlich durch wachsende Einsichten auf den Gebieten von Medizin, Architektur usw., daß Fortschritte erzielt wurden. Auch heute noch ist das erwähnte Bedürfnis oft die treibende Kraft hinter den Entwicklungen in den Naturwissenschaften. Diese Entwicklungen werden aber ebenso vorangetrieben vom alten Ideal der Erkenntnis um der Erkenntnis willen 73. Das ist besonders deutlich zu sehen im Falle der Astronomie und der Kosmologie. Besagtes Ideal war auch entscheidend für die Arbeit Galileis selbst. Mit ihr beginnt die Erfolgsgeschichte der modernen Naturwissenschaft.
Die Verschmelzung der antiken griechisch-römischen Kultur mit dem Christentum mag einen idealen Nährboden für die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft geschaffen haben, sie erscheint nichtsdestotrotz recht spät auf der Bühne der Geschichte. A. van Melsen erklärt dies folgendermaßen 74: Naturwissenschaft kann sich erst entwickeln, wenn es gelungen ist, eine gesetzmäßige Beziehung zwischen bestimmten Aspekten des Materiellen zu enthüllen. Aber eben dieser Anfang der Naturwissenschaft ist schwierig. Angesichts der Vielfalt der Aspekte der materiellen Welt – Farbe, Klang, Gewicht, Härte, Umfang usw. – ist es nicht immer einfach zu entdecken, welche Aspekte miteinander zusammenhängen bzw. wie die miteinander zusammenhängenden Aspekte sich zueinander verhalten. Doch wenn man einmal einen bestimmten Zusammenhang zwischen bestimmten Faktoren entdeckt und die Weise, in der man ihn entdeckt hat, gesichert hat, ist man orientiert für weitere Forschung, sowohl hinsichtlich ihrer Methode als auch hinsichtlich ihres Inhalts. Man kennt relevante Faktoren und kann ihren Einfluß auf andere Faktoren untersuchen. Aber einer solchen Initialentdeckung, die den Anstoß zu einer Reihe weiterer Entdeckungen zu geben vermag, geht eine Reihe fehlgeschlagener Versuche, gesetzmäßige Beziehungen zwischen natürlichen Faktoren zu entdecken, voraus. Diese fehlgeschlagenen Versuche gehören zum Fortschritt der Naturwissenschaft, denn sie erlauben die Eliminierung offensichtlich falscher Vorschläge zur Lösung von Problemen. Die Tatsache, daß man keinen Zusammenhang zwischen bestimmten Phänomenen sieht oder einen Zusammenhang zwischen bestimmten Phänomenen vermutet, ohne ihn genau bestimmen zu können, ist frustrierend und erklärt, warum man seine Aufmerksamkeit vom Studium der empirischen Natur abwendet und sich dem Studium von Problemen, deren Lösung nicht unerreichbar scheint, widmet. Das sind Probleme der Philosophie, einschließlich der Naturphilosophie, und der Theologie, aber auch der Mathematik und der Logik. Wenn die Sinneserfahrung in Philosophie, Theologie, Mathematik und Logik überhaupt eine Rolle spielt, ist sie jener des rationalen Denkens, das in den genannten Disziplinen in vielen Hinsichten sich selbst genügt, untergeordnet.
Wir haben verschiedene Gründe für die langsame Entwicklung der Naturwissenschaft in Spätantike und Mittelalter erwähnt. Zunächst verwiesen wir auf die vormoderne Denkform. Das vormoderne Denken ist nicht so sehr interessiert an dem, was vorübergeht, wozu im wesentlichen die ganze materielle Welt gehört, als vielmehr am Sein – an dem, was bleibt –, nämlich insofern dieses als wesentlich fürs menschliche Dasein betrachtet wird. Sodann verwiesen wir auf die turbulente soziale – gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche – und existentielle Lage der Menschen, besonders im Frühmittelalter, die kaum unabhängige wissenschaftliche Forschung erlaubte und stattdessen eine Kultur des Studiums bestehender Werke begünstigte. Sie sollte bis ins Spätmittelalter hinein dominant bleiben. Schließlich verwiesen wir auf die Anfangsschwierigkeit, mit der die Naturwissenschaft im engeren Sinne des Wortes – im Sinne, im dem die Moderne sie versteht – unvermeidlich konfrontiert wird, und die darin besteht, inmitten der vielen Aspekte des materiellen Seienden diejenigen, zwischen denen eine gesetzmäßige Beziehung waltet, zu identifizieren und die genaue Art dieser Beziehung zu bestimmen.
Die verschiedenen Faktoren, die als Ursachen der langsamen Entwicklung der Naturwissenschaft in vormoderner Zeit benannt wurden, hängen natürlich miteinander zusammen. In einer Welt, in der nichts sicher ist und das Leben ständig bedroht wird von Krankheit, Gewalt und Kargheit – Epidemien, Kriegen und Hunger –, sucht der Mensch nach einem Halt, und diesen sucht er spontan nicht in der Welt um sich herum, welche Welt ja genau der Bereich der Instabilität und des Todes ist, sondern in etwas, das die Welt transzendiert 75. Der Mensch neigt insofern dazu, so zu handeln, als er das Leben in dieser Welt als chaotisch erfährt, so daß er sich nicht ermutigt fühlt, eine immanente Logik in den Ereignissen, denen gegenüber er sich hilflos vorkommt, zu suchen 76. Er wendet sich von der chaotischen Welt ab und sucht Heil im transzendenten Sein. So wird die Entwicklung der Naturwissenschaft verzögert. Die Untersuchung naturwissenschaftlicher Probleme verspricht keinen großen Erfolg, und sie erscheint angesichts der dringenden Probleme des täglichen Lebens wie ein Luxus, den sich nur eine kleine Elite vom Leben Privilegierter leisten kann – so wie in der klassischen Antike die Philosophie etwas für eine kleine Gruppe freier Menschen war 77.
12„Es gibt […] niemanden, […] der bestreiten möchte“, daß Galilei „wohl am meisten zum Zustandekommen der klassischen Naturwissenschaft beigetragen hat”. Er ist „die zentrale Gestalt im Übergang vom antik-mittelalterlichen zum klassischen naturwissenschaftlichen Denken“, schreibt DIJKSTERHUIS, Mechanisering, S. 368-369.
13Das ist zumindest die „lange Zeit selbstverständliche Beurteilung der geistesgeschichtlichen Entwicklung“ gewesen (WALDENFELS, Mythos, S. 259). Dieser Beurteilung entsprechend sprach man lange unproblematisch vom Übergang „vom Mythos zum Logos“, aber heute wird anerkannt, daß „der Mythos seinen eigenen Logos offenbart“ ( ibid., 266).
Читать дальше