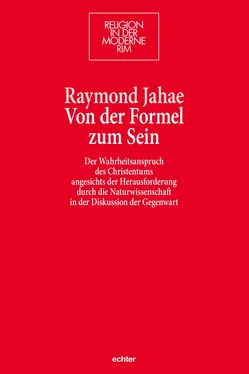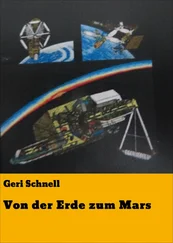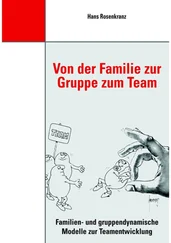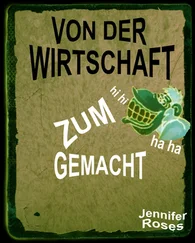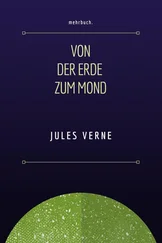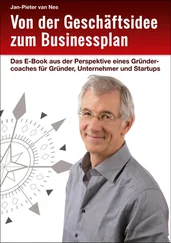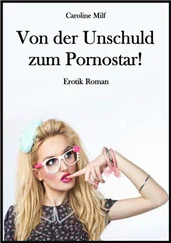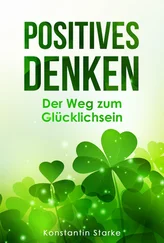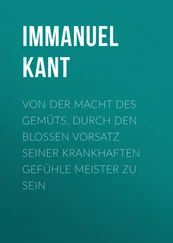Trotz der Mängel, die das Christentum in der Philosophie erblickte, suchte es ein ernsthaftes Gespräch mit ihr. J. Ratzinger sucht die Erklärung dieses Phänomens darin, daß beide, Christentum und Philosophie, auf der Suche sind nach der Wahrheit, die durch rationales Denken entdeckt werden soll. Er behauptet sogar, daß das Christentum aus der Verbindung des Judentums mit der griechischen Philosophie gewachsen sei. Es wird jedenfalls auf breiter Ebene anerkannt, daß das Christentum viel von sich selbst wiedererkannte im Platonismus mit dessen Nachdruck auf die transzendente Idee des Guten. Nach den Hinweisen H. Rombachs können wir sagen, daß sowohl die antike Philosophie als auch das Christentum das Sein im Sinne dessen, was für den Menschen wesentlich ist, suchen. Es ist nicht einzusehen, wie man redlich behaupten kann, daß das Christentum die Denkform von der Philosophie (oder den Philosophien) des Griechentums bzw. Hellenismus übernommen habe, obwohl dem Christentum diese Denkform zutiefst fremd war. Es hat vielmehr den Anschein, daß das Christentum die Denkform der griechischen Philosophie als ein veritables Movens in sich einbegreift, bzw. diese Denkform den existentiellen und konzeptuellen Horizont der ganzen hellenistischen Welt, die das Judentum in den Jahrhunderten um den Beginn unserer Zeitrechnung und damit auch die Geburtsstätte des Christentums umfaßte, ausmachte.
Für diese Denkform nimmt die archimedische Naturwissenschaft – die die moderne und heutige Naturwissenschaft antizipiert – natürlich nur einen marginalen Platz im Ganzen des Denkens und Wissens ein. Die Vorsokratiker, besonders die ionischen Naturphilosophen, sind am Materiellen interessiert, aber genau insofern, als in ihm die arché, das Prinzip – das Bleibende oder Wesentliche – alles dessen, was ist, vermutet wird. Die Vorsokratiker sind weniger an der spezifischen Natur der Verhältnisse zwischen bestimmten Phänomenen interessiert. Der Platonismus bestreitet sogar, daß die materielle Welt der Gegenstand von Erkenntnis im strengen Sinne des Wortes sein könne. Erkenntnis ist Erkenntnis dessen, was ist im Sinne dessen, was bleibt; und was bleibt, ist nichts Materielles, sondern die Welt der Ideen. Anders als der Platonismus hält der Aristotelismus das Materielle für erkennbar, aber er faßt die Naturerkenntnis nicht primär im Sinne der archimedischen oder modernen Naturwissenschaft auf. Denn die Aspekte des materiellen Seienden und ihre gegenseitigen Verhältnisse, die die archimedische und die moderne Naturwissenschaft untersuchen – Zeit, Ort, Gewicht, Volumen, Bewegung usw. –, sind akzidentell und haben eine nur marginale Beziehung zur Substanz eines Dinges. Die Substanz wird durch die Form erfaßt. Es verdankt sich dem Wesen oder der Natur der Substanz, daß wir wissen, was Substanz als sie selbst ist. Die Mathematik spielt insofern keine Rolle in dieser Art von Erkenntnis, als das Wesen einer Substanz – das, was sie ist – qualitativer Natur und somit für mathematische Berechnung nicht offen ist. Der Aristotelismus behält jedoch im Ganzen der Erkenntnis einen Platz für die mathematische Naturwissenschaft im Stile Archimedes’. Es ist aber ein marginaler Platz. Schließlich studiert die mathematische Naturwissenschaft bloß einige Akzidenzien des materiellen Seienden. Für den Aristotelismus ist Erkenntnis wirklich Erkenntnis der Substanz durch ihr Wesen, ihre Form oder Natur. Grundsätzlich beabsichtigt die Naturwissenschaft, wie sie Archimedes und Galilei entwickeln, nicht so sehr die Formen von Substanzen als vielmehr die quantitativen Beziehungen zwischen quantitativen und/oder quantifizierbaren Aspekten – wie Gewicht bzw. Masse, Volumen und Ort – von Entitäten, deren Form, Wesen oder Natur – das, was sie sind – im Prinzip unerheblich ist, zu erfassen. Die aristotelisch inspirierte Idee von Wesenserkenntnis spielt aber eine Rolle für die Naturwissenschaft im Stile Archimedes’ und Galileis, wenngleich nicht unbedingt explizit. Denn diese Art von Naturwissenschaft kann nicht darauf verzichten, etwas als das, was es ist, zu erfassen und so von dem, was es nicht ist, zu unterscheiden. So wie in Chemie und Biologie etwas als das, was es ist, erfaßt wird – z.B. als dieses oder jenes bestimmte chemische Element, als diese oder jene bestimmte Art von Lebewesen –, werden in der Physik Entitäten und Phänomene erfaßt als das, was sie sind: als Elektronen, Lichtwellen usw. Nach Rombach aber können wir sagen, daß die moderne Naturwissenschaft kraft der ihr zugrundeliegenden Denkform nicht interessiert ist am Sein im Sinne dessen, was für den Menschen wesentlich ist, sondern vielmehr an der Art und Weise, wie in der materiellen Welt eine Entität auf eine andere verweist (z.B. der Art und Weise, wie Energie auf Masse verweist). Als Wissenschaft des Materiellen ist die moderne Naturwissenschaft weniger interessiert an dem, was bleibt, als an dem, was sich verändert, wie Masse und Volumen. Diese Beobachtung wird nicht widerlegt durch den Einwand, daß die moderne Wissenschaft nach den im Prinzip immer und überall gültigen Gesetzen, die die Veränderung bestimmen, sucht. Es bleibt wahr, daß die moderne Wissenschaft nicht an „substanziellem Sein“ welcher Art auch immer interessiert ist – und es dann auch, was kaum überraschen kann, nicht findet.
Die Denkform des Christentums ist (oder war) die Denkform der griechischen Philosophie. Beide suchen insofern das Sein – das, was ist –, als es fürs menschliche Leben wesentlich ist. Ebensowenig wie die griechische Philosophie schließt das Christentum die archimedische Naturwissenschaft aus, und ebensowenig wie die griechische Philosophie hält das Christentum die archimedische Wissenschaft für echt bedeutsam. Dieses Ergebnis unserer bisherigen Untersuchung wird bekräftigt durch einen Blick auf das, was die Offenbarung über die Beziehung des Menschen zur Natur sagt.
5.2 Über die Beziehung des Menschen zur Natur nach der Heiligen Schrift
Die Denkform, die der griechischen Philosophie zugrunde liegt, ist derart, daß die Aufmerksamkeit, die sie der Naturwissenschaft im Sinne Archimedes’ und Galileis schenkt, bescheiden ausfällt. Durch diese Art von Naturwissenschaft mag man etwas lernen über einige Akzidenzien des materiellen Seienden, man dringt aber nicht zum Sein als solchem vor, und genau dieses ist es, was zählt im menschlichen Leben. Das Christentum teilt diese Denkform mit der griechischen Philosophie, und in der vom Christentum beherrschten Kultur begegnen wir oft derselben Haltung der Naturwissenschaft gegenüber wie in der vorchristlichen griechischen Kultur. Der christlichen Haltung der Naturwissenschaft gegenüber soll aber mehr im Detail nachgegangen werden. Die Haltung des Christentums der Naturwissenschaft gegenüber kann nicht einfach mit jener der griechischen Philosophie identifiziert werden, weil, wie wir bereits herausstellten, Christentum und griechische Philosophie nicht identisch sind.
1 Offenbarung, Gott, Schöpfung, Übel und Erlösung
Das vorchristliche Judentum, in dem die Wurzeln des Christentums liegen, betrachtet sich selbst als die Frucht einer fortschreitenden Selbstoffenbarung Gottes. Das Volk Israel verstand sich selbst als Werk Gottes. Er hat das Volk durch eine Reihe historischer Ereignisse zu Seinem Volk gemacht. Angefangen mit der Berufung Abrahams, gipfelt sie in der Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten, der Gabe des Gesetzes des Mose ans Volk und der Ankunft in Kanaan, dem verheißenen Land. Israel ist dazu auserwählt, durch seinen Gehorsam Gottes Willen, dem Gesetze, gegenüber ein Zeichen des Heils für die Völker zu sein. Gottes Plan besteht darin, daß die Nationen, indem sie dieses Zeichen sehen, von Israel angezogen werden und des Heiles, das in ihm aufleuchtet, teilhaft werden 53. Das Leben im Gehorsam gegenüber Gott, das Israel zu leben auserwählt ist, verwirklicht und manifestiert sich in gerechten Beziehungen in allen Bereichen des menschlichen Lebens, sowohl in persönlichen als auch in gesellschaftlichen, in sexuellen und familialen nicht weniger als in politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Gerechtigkeit, Friede und Wohlergehen mögen die am meisten ins Auge springenden Komponenten des Heils sein, die Herzensmitte aber ist die rechte Beziehung zu Gott. Das Heil ist Gottes Werk. Die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten und das Gesetz, das die religiöse und soziale Ordnung in Israel bestimmt, sind Gottes Gabe. Es ist genau die Untreue gegenüber Gott, die Israel, einmal im verheißenen Land angekommen, in Chaos und Elend werfen wird. Sie gipfeln in der Unterdrückung und Versklavung des Volkes durch fremde Mächte und im Verlust des verheißenen Landes während des Exils in Babylonien. Doch sind die Beziehungen im Volke schon vor dieser historischen Katastrophe gestört; und es ist dies das Ergebnis eines Mangels an wahrer Gottesfurcht. Die Propheten, die zum Volke gesandt werden, beklagen Apostasie (Untreue gegenüber Jahwe und die Verehrung falscher Götter) und soziale Ungerechtigkeit (besonders die Unterdrückung der Armen).
Читать дальше