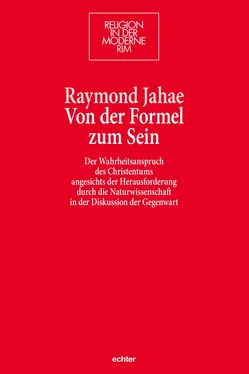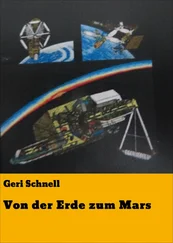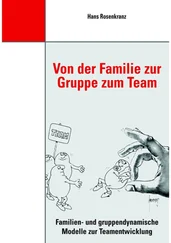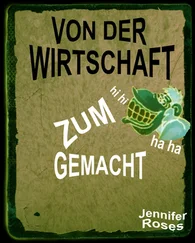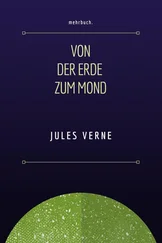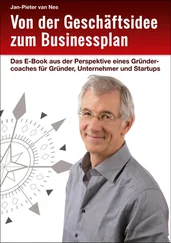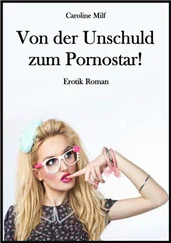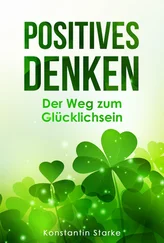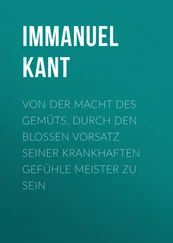4. Freilich: Obwohl in der vom Christentum beherrschten Kultur der Spätantike und des Mittelalters das intellektuelle Leben im Laufe der Zeit eine große Entwicklung durchmachte, wurden auf dem Feld der Naturwissenschaft und der Naturphilosophie de facto kaum Fortschritte erzielt. Das mag z.T. daran liegen, daß im christlichen Glaubensleben die Beziehung des Menschen zu Gott, zu seinem Nächsten und zu sich selbst Priorität hat und der Erforschung der Natur um ihrer selbst willen keine grundsätzliche Bedeutung beigemessen wird. Das ist bereits in der hl. Schrift so, und es wird in der christlichen Kultur so bleiben bis zum Ende des Mittelalters 67. Das Ziel des menschlichen Daseins wird in der Gemeinschaft mit Gott und der beseligenden Gottesschau gesehen 68, und dementsprechend besetzen Theologie und Philosophie – insbesondere Metaphysik – die ersten Plätze unter den Wissenschaften. Obwohl die Aussage des hl. Thomas von Aquin, daß alle Erkenntnis mit den Sinnen anfängt, gelesen werden könnte als ein Bekenntnis, daß für ihn Theologie und Philosophie durch die rationale Naturerkenntnis vermittelt werden, bleibt es so, daß das, was für ihn wirklich wichtig ist, weniger Naturwissenschaft im Sinne detaillierter Erkenntnis konkreter empirischer Tatsachen wie sie in der Moderne entwickelt werden wird, ist als die philosophische, insbesondere ontologische Analyse, im Geiste des Aristoteles, der formalen Struktur des materiellen Seienden als ein Medium der Metaphysik und der Theologie. Solche Naturphilosophie hängt zweifellos von der Sinneserfahrung ab – in der Konfrontation mit ihr hat sich die Naturphilosophie zu bewähren, sie darf ihr nicht widersprechen –, kann aber nichtsdestotrotz in hohem Maße a priori entwickelt werden 69. In diesem Zusammenhang muß auch gesagt werden, daß die Aussage des hl. Paulus, daß der Mensch Gott und Seinen Willen durch die Schöpfung erkennen kann, kein Auftrag, wie Archimedes oder Galilei Naturwissenschaft im Sinne detaillierter Erkenntnis konkreter empirischer Tatsachen mit Blick auf die Erkenntnis Gottes anzustreben, ist. Wie bereits gesagt, verweist diese Aussage auf die Tatsache, daß durch den Blick auf die Natur dem Menschen bewußt wird, daß sich in ihr eine Ordnung, durch die alles, was lebt, existieren kann, auftut und daß die Natur in ihrer Kontingenz somit auf einen intelligenten, mächtigen und guten Schöpfer und Herrscher der Welt, den transzendenten Gott, verweist. Auch der hl. Thomas von Aquin denkt so 70. Die Beziehung zu Gott ist demnach kaum abhängig von der Naturwissenschaft im Sinne detaillierter Erkenntnis bestimmter, konkreter Phänomene (oder Arten derselben), so daß diese Art von Wissenschaft von sekundärer Bedeutung ist für die mittelalterliche Person, die der Beziehung zu Gott absolute Priorität vor allem anderen zuerkennt. Das ist aber nicht der einzige Grund, und unserer Ansicht nach nicht einmal der wichtigste Grund, warum Naturphilosophie und Naturwissenschaft in der vom Christentum beherrschten Kultur der Spätantike und des Mittelalters nur geringe Fortschritte verbuchten. Tatsächlich nahm in der zweiten Hälfte des Mittelalters das Interesse für Naturphilosophie und Naturwissenschaft zu. Der relative Mangel an Interesse in früheren Perioden hat wichtigere Gründe als die aus der christlichen Spiritualität sich ergebenden.
5.3 Geschichtliche Gründe für die schwache Entwicklung der Naturwissenschaft in Spätantike und Mittelalter
1 Die geschichtliche Entwicklung des intellektuellen Lebens im Mittelalter
Vorher gaben wir eine grobe Skizze der Entwicklung des rationalen Denkens über die Natur in der vorchristlichen europäischen Antike. Es ging öfter um Naturphilosophie als um Naturwissenschaft. Die Denker der Antike skizzieren oft die Struktur des Seins des materiellen Seienden aus metaphysischer oder ontologischer Perspektive – im Rahmen einer Untersuchung des Seienden als solchen – und geben selten eine derartige Erklärung spezifischer Phänomene (oder Arten derselben), daß Vorhersagen natürlicher Fakten möglich werden. Die Astronomie als mathematische Beschreibung der Bewegungen der „Himmelskörper“ ist gut entwickelt, schließt aber kaum eine empirisch überprüfbare physikalische Erklärung dessen, was beschrieben wird, mit ein. Manche Denker suchen ein Prinzip ( arché ) dessen, was ist, in etwas Materiellem, auf das alles, was erscheint oder ist, zurückgeführt werden muß, aber sie kommen kaum weiter als auf mehr oder weniger durchdachte, auf einer Verbindung von Wahrnehmung und Räsonnement beruhende Vermutungen. In den Werken mancher Autoren begegneten wir freilich detaillierten empirischen Studien konkreter Phänomene (oder Arten derselben), die in die Richtung heutiger Naturwissenschaft gehen. Aristoteles hat zahlreiche Phänomene in der lebendigen Natur beschrieben. Er hat insbesondere viele Arten von Tieren katalogisiert. Archimedes kann insofern als ein entfernter Vorläufer heutiger Physik gelten, als er aufgrund experimenteller empirischer Forschung „Naturgesetze“ über quantitative Aspekte des materiellen Seienden formulierte, derart, daß durch Berechnung Phänomene vorausgesagt werden können. Mit dieser Denkform blieb er eine isolierte Gestalt in der Antike. Im zweiten Jahrhundert n.Chr. entwickelt Ptolemäus jenes mathematische Weltbild, das mehr als ein Jahrtausend lang funktionieren wird als das Modell, das es Menschen erlaubt, die Bewegungen der „Himmelskörper“ zu berechnen, obwohl es im Laufe der Zeit mehrmals korrigiert werden muß. Um diese Zeit kommt das rationale Denken über die Natur in Europa zum Stillstand – also geraume Zeit bevor das Christentum die vorherrschende kulturelle Kraft in Europe wird. Es kann demnach nicht davon beschuldigt werden, das rationale Denken über die Natur stillgelegt zu haben. Lange bevor das Christentum die europäische Kultur entscheidend gestalten konnte, war die Zeit des Fortschritts im rationalen Denken über die Natur schon Vergangenheit. Wie wir gesehen haben, kannte die vormoderne Zeit kaum so etwas wie Naturwissenschaft im heutigen Sinne des Wortes. Wie wir bald sehen werden, kann der späte Durchbruch dieser Art von Wissenschaft nicht einfach durch den Mangel an Interesse für die Naturwissenschaften im Christentum erklärt werden.
Der Untergang des weströmischen Reiches und die „Völkerwanderung“ (um 400-800 n.Chr.) machten die unabhängige Ausübung von Wissenschaft und Philosophie in Westeuropa fast unmöglich. Dank der Kirche und besonders den Orden konnte viel vom kulturellen Erbe der klassischen Antike gerettet werden. Bis ins 11. Jahrhundert hinein bestand die intellektuelle Kultur des Mittelalters hauptsächlich aus Abschreiben und Weitergeben bestehender wissenschaftlicher, philosophischer und theologischer Werke. Mehr war kaum denkbar. Die Klosterschulen und Domschulen gelten als die Vorläufer der Universitäten; deren Geburtstort im 12.-13. Jahrhundert waren die Domschulen. Die Theologie wird als die Höchstform der Wissenschaft angesehen; aber die Universitäten haben auch Platz für die Profanwissenschaften, besonders für Medizin und Jura. Diese Periode kennt erhitzte Diskussionen über das Verhältnis von Glauben und Vernunft sowie die Beziehung zwischen Theologie und Philosophie. Das hängt z.T. zusammen mit der Verbreitung einiger Hauptwerke Aristoteles’ im Europa des 13. Jahrhunderts, nachdem sie dort lange Zeit unbekannt geblieben waren. Die vom hl. Thomas von Aquin verteidigte Idee von Glauben (Offenbarung) und Vernunft als zwei Erkenntnisquellen, die einander nicht widersprechen können, wird bald auf breiter Ebene akzeptiert werden. In der Entwicklung dieser Idee und der Universitäten kann man einen ersten Schritt auf dem Weg zur Säkularisierung des Denkens, d.h. zu seiner Loslösung von religiöskirchlichen Vorgaben, sehen. Die so verstandene Säkularisierung ist insofern theologisch legitim, als sie dem Gebot, das nach Gen. 1 dem Menschen mit der Schöpfung gegeben worden ist, entspricht, nämlich dem Gebot, die Erde zu kultivieren und sich sie in diesem Sinn untertan zu machen, somit die Natur unabhängig von Theologumena zu erforschen. Für die katholische Theologie bedeutet der Unterschied zwischen natürlicher und übernatürlicher Ordnung, daß das menschliche Dasein auch ohne die übernatürliche Vergöttlichung des Menschen Sinn hat 71. Diese theologische Konzeption gesteht der „natürlichen“, nicht vom Glauben erleuchteten Vernunft, Kompetenz in Angelegenheiten, die nicht unmittelbar das „übernatürliche“ Ziel des Menschen betreffen, zu – und ist damit die theologische Rechtfertigung der Autonomie, die die „profane“ Wissenschaft später für sich einfordern wird. Überdies ist die natürliche Vernunft auch kompetent in theologischen Angelegenheiten, obwohl sie die geoffenbarte(n) Glaubenswahrheit(en) nicht ganz aus sich selbst heraus entdecken kann. Die natürliche Vernunft ist natürlicher Gotteserkenntnis fähig. Die theologische Anerkennung der Legitimität des Gebrauchs der nicht vom Glauben erleuchteten Vernunft berechtigt also nicht zu einer komplett atheistischen oder agnostischen Weltsicht. Die Kirche hat die Vorstellung, daß Vernunft und Glauben einander widersprechen könnten, insbesondere, daß etwas in der Philosophie wahr, in der Theologie aber falsch sein könnte (oder umgekehrt), immer abgelehnt.
Читать дальше