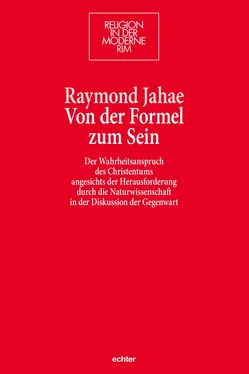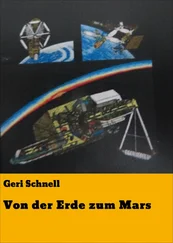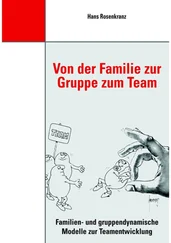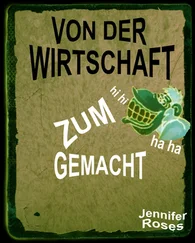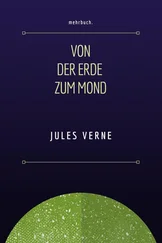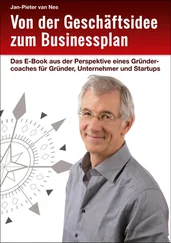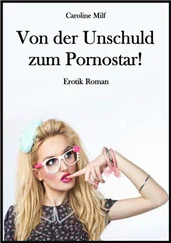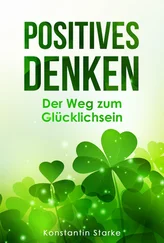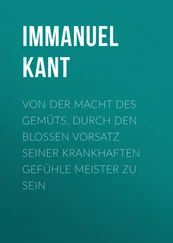An den Universitäten wurden verschiedene Profanwissenschaften um ihrer selbst willen geübt, aber es gab keine unabhängige Naturwissenschaft. Die Praxis der Naturphilosophie und Naturwissenschaft war dem Mittelalter jedoch nicht fremd. Doch die Rolle, die die empirische Naturforschung im mittelalterlichen wissenschaftlichen Betrieb spielte, war eher marginal. Das hat etwas mit der Eigenart des mittelalterlichen Wissenschaftsbetriebs zu tun. Wie gesagt, war er zunächst hauptsächlich beschränkt aufs Kopieren und Weitergeben bekannter theologischer, philosophischer und wissenschaftlicher Werke. Später transformierte sich diese Praxis in deren Diskussion und Kommentierung. Diese Veränderung war der Reflex der Beobachtung von Spannungen zwischen den Äußerungen der verschiedenen „Autoritäten“, also der Autoren, deren Werke studiert, kopiert und weitergegeben wurden. Der geographische, kulturelle, historische und religiöse Hintergrund der „Autoritäten“ war sehr heterogen. Unter ihnen treffen wir griechische und römische, heidnische und arabische, islamische Philosophen, christliche Autoren usw. an. Ebenso heterogen waren die literarischen Gattungen der studierten Werke: Wir begegnen unter ihnen doktrinären Definitionen des Lehramts der Kirche, Gebeten und Katechesen der Kirchenväter, philosophischen Traktaten usw. Da all diese Texte zumindest auf den ersten Blick inhaltlich nicht immer miteinander übereinstimmten, aber gleichwohl von Autoren, die anerkannte Autoritäten waren, stammten, wollte der mittelalterliche Gelehrte untersuchen, ob anscheinend einander widersprechende Aussagen nicht dennoch miteinander versöhnt werden könnten durch eine logische Analyse, die ihre Tragweite und Bedeutung ans Licht brächte. Die mittelalterliche intellektuelle Kultur bestand somit großenteils aus dem Studium bestehender Werke, einschließlich der Studien in Naturphilosophie und Naturwissenschaft. Diese Art intellektueller Arbeit stimuliert aber nicht die empirische Naturforschung. Die Bedeutung des Empirischen und insbesondere des Experimentellen für die Naturforschung wird gleichwohl erkannt von zwei englischen Denkern aus dem 13. Jahrhundert, Robert Grosseteste und Roger Bacon. Ersterer macht nicht nur die Naturwissenschaft von der Mathematik abhängig, sondern erkennt auch, daß die Naturwissenschaft methodisch arbeitet mit dem, was später Induktion genannt werden wird. Für letzteren ist die Bedeutung der „Autoritäten“ für die Naturwissenschaft der Erfahrung untergeordnet. Die Anerkennung des empirischen Charakters der Naturwissenschaft wird philosophisch untermauert werden im Nominalismus. Er bestreitet, daß ein bestimmter, distinkter Begriff – der in Sprache und Denken im Prinzip auf verschiedene individuelle Gegenstände angewandt werden kann und faktisch auch darauf angewandt wird – einer bestimmten, distinkten Wirklichkeit entspricht. Der Nominalismus impliziert damit, daß ein jedes individuelles materielles Seiendes in seiner Unterschiedenheit nur durch die Sinneswahrnehmung erkannt werden kann. Er entspricht insofern der christlichen Lehre von Gott und der Schöpfung, als fürs Christentum Gottes schöpferischer Akt, wenn überhaupt, dann nur an logische Notwendigkeit gebunden ist, mitnichten aber an die vermeintliche Notwendigkeit ontologischer Wesensbestimmungen, die angeblich dem Schöpfungswerk Standards setzten. Man kann sagen, daß die darwinistische Evolutionstheorie die nominalistische Logik verkörpert, da für diese Theorie ein Lebewesen nicht einfach als ein repräsentatives Exemplar einer bestimmten, klar definierten Art betrachtet werden kann, sondern immer nach seinen individuellen Charakteristiken bestimmt werden muß.
Im Mittelalter wird Fortschritt auf dem Gebiete der Naturwissenschaft hauptsächlich durch die Entwicklung der Militärtechnik, Architektur, Medizin, Alchemie usw. erzielt. Der Mensch lernt die Materie, ihre Qualitäten und Aspekte, primär durch die praktische Arbeit mit ihr zur Verwirklichung der Ziele, die er sich selbst setzt, kennen. Diese Art des praktischen Umgangs mit der Natur entspricht unmittelbarer als die theoretische Betrachtung der Aufgabe, die der Mensch nach Gen. 1 mit der Schöpfung erhalten hat, und wird auch den Übergang zur modernen Naturwissenschaft im Laufe des 16. Jahrhunderts einleiten. So ist die Entdeckung der Bewegungsgesetze teils der Untersuchung des Fallens und des Wurfes von Körpern mit Blick auf die Entwicklung von Waffenzeug zu verdanken. Der moderne Geist ist sich offensichtlich dessen bewußt, daß seine Beziehung zur Natur und seine Erkenntnis von ihr höchst praktisch sind, ohne daß es dem objektiven Wert der Erkenntnis schaden müßte. Nach Francis Bacon und René Descartes dient des Menschen Erkenntnis der Natur deren Beherrschung, und Immanuel Kant weiß, daß die Natur dem Menschen nur auf das, wonach er sie fragt, antwortet.
2 Die Bedeutung des Mittelalters für die Geburt der modernen Naturwissenschaft
Das Werk Galileis wird meistens als der Beginn der Naturwissenschaft, wie wir sie heute kennen, betrachtet. Das erklärt sich daraus, daß Galilei zum Gewinn von Naturerkenntnis als erster konsequent jene Arbeitsmethode, die seitdem die rationale Erforschung der Natur, vor allem der anorganischen, leitet, angewandt hat. Aufgrund der Sinneswahrnehmung wird eine persistierende systematische („gesetzmäßige“) Beziehung zwischen meßbaren Aspekten des Materiellen vermutet; sie wird ausgedrückt in einer mathematischen Gleichung; die so formulierte Regel wird experimentell mit der Sinneserfahrung konfrontiert; und der experimentelle Test wird die anfängliche Vermutung entweder bestätigen oder widerlegen. Die Einsichten, die durch die Anwendung dieser Methode in der Naturwissenschaft gewonnen werden, erlauben Vorhersagen konkreter natürlicher Phänomene und Anwendungen in der Technologie. Es ist vornehmlich die Technologie, die die Naturwissenschaft im Stile Galileis, die im Werke Newtons einen ersten – vorläufigen – krönenden Abschluß fand, ermöglicht hat, wodurch das menschliche Dasein und das Antlitz der Erde in beispielloser Weise verändert worden sind. Diese Art von Naturwissenschaft taucht in der Geschichte der Menschheit relativ spät auf. Die moderne Naturwissenschaft entstand an einem ganz bestimmten Ort zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt und somit in einer ganz bestimmten Kultur, nämlich in der westeuropäischen Kultur des 16. und 17. Jahrhunderts. Sie hatte sich entwickelt aus der Begegnung und Verschmelzung des griechischen und römischen Denkens der klassischen Antike mit dem Christentum und war nach Leuten wie P. Duhem und S. Jaki der ideale Nährboden für die moderne Naturwissenschaft, so daß es kein Zufall ist, daß sie sich eben im Westeuropa des 17. Jahrhunderts entwickelte und nicht anderswo.
Es stimmt, daß gegen Ende des Mittelalters sich eine Kultur, die in gewissen Hinsichten die Geburt der modernen Naturwissenschaft fördert, entwickelt. Die traditionelle christliche Lehre, daß Gott alles in absoluter Freiheit, mit Weisheit und aus Güte erschaffen und den Menschen dazu auserwählt habe, sich die Erde untertan zu machen, ermutigt ihn dazu, die Welt zu erforschen. Sie besitzt eine rationale Struktur, die als solche dem menschlichen Verstand zugänglich ist, und hat nichts Sakrales oder Beängstigendes an sich. Die wiedergefundene Vertrautheit mit dem literarischen Erbe der klassischen Antike einerseits und die theologische Anerkennung des eigenen Sinnes der natürlichen Ordnung andererseits begünstigen das intellektuelle Interesse für die Welt und das menschliche Dasein als solche, unabhängig von deren religiösen Bedeutung. Der Nominalismus, der konsequent die Freiheit Gottes verteidigt und vielleicht auch deswegen die Philosophie an den Universitäten gegen Ende des Mittelalters beherrscht, widmet seine Aufmerksamkeit dem Besonderen und Einmaligen und impliziert die Anerkennung der Bedeutung der Sinneswahrnehmung für die Naturerkenntnis.
Читать дальше