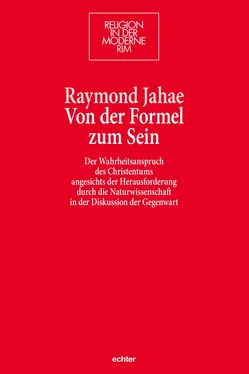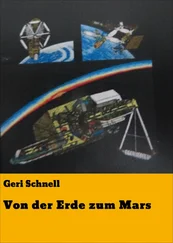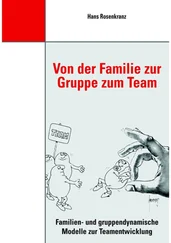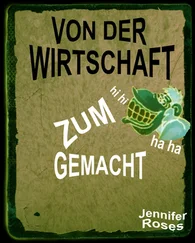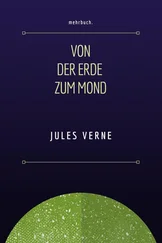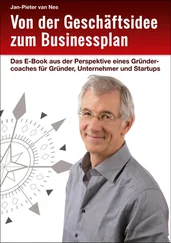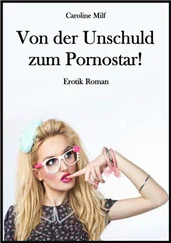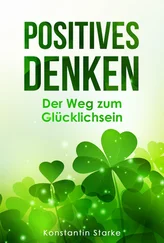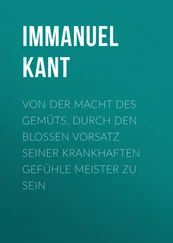1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Die Aufmerksamkeit Heraklits, Parmenides’ und Demokrits galt primär dem Sein als solchem, so daß in ihrem Denken die empirisch wahrnehmbaren Unterschiede in der Natur wie die Unterschiede zwischen lebendigen und leblosen Seienden keine große Rolle spielten 36. Der Hylemorphismus des Aristoteles ist eine philosophische Konzeption des zusammengesetzten Seienden als solchen und kann darum zumindest im Prinzip sowohl auf die leblose als auch auf die lebendige Natur angewandt werden. Aber abgesehen davon, daß er den Hylemorphismus entwickelte, widmete sich Aristoteles auch der empirischen biologischen Erforschung der konkreten Arten der Lebewesen. Seine Weise, die Arten der Lebewesen mit Blick sowohl auf ihre mit anderen geteilten als auch auf ihre je spezifischen, distinktiven Züge zu katalogisieren, ist bis heute ein wichtiger Bestandteil der biologischen Forschung geblieben. Aristoteles kennt die Lehre eines transzendenten Schöpfers der Welt nicht. Für Aristoteles ist die Welt mit ihrer immanenten Ordnung ewig, und die Arten der Lebewesen sind es auch. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts begann die moderne Wissenschaft, Abstand vom „statischen“ Bild der lebendigen Natur, das von einer „Evolution der Arten“ nichts weiß, zu gewinnen. Ein „dynamisches“ Bild der Natur bestand jedoch bereits vor Aristoteles 37. Die Naturphilosophie des Empedokles (5. Jahrhundert v.Chr.) kann verstanden werden als ein Versuch, das Dilemma, mit dem die entgegengesetzten Positionen Heraklits und Parmenides’ das Denken konfrontiert hatten, nämlich das Dilemma der Beziehung zwischen Sein und Werden oder zwischen der Einheit des Seins und seiner inneren Differenziertheit, zu überwinden. Empedokles identifiziert Erde, Luft, Wasser und Feuer als die vier „Wurzeln“ oder als die letzten Bestandteile des Kosmos. Sie sind nicht geworden, sie ändern sich nicht und sind unvergänglich. Das, was sich ändert, ist ihre Mischung, und mit ihr die Weise, wie sie verteilt sind. Ihre gegenseitige Beziehung wird bestimmt von Liebe und Streit. Durch die Liebe verbinden sie sich miteinander, durch Streit trennen sie sich voneinander. Liebe und Streit gehen endlos ineinander über. So ist der Kosmos dem endlosen zyklischen Prozeß der Amalgamation und Trennung der „Wurzeln“ unterworfen. Aus ihnen besteht alles im Kosmos, einschließlich der Seele. Die Lebewesen entstehen durch einen Entwicklungsprozeß. Erst entstehen die „homogenen Stoffe“ wie Blut und Fleisch, dann die verschiedenen Glieder; anschließend verbinden sich die Glieder miteinander. Dieser Prozeß ist „zufällig“. Die anscheinend harmonische Organisation des Organismus, in dem alles mit Blick auf ein Ziel zu geschehen scheint (z.B. wachsen die passend gebildeten Zähne am passenden Ort im Mund, damit Teile dessen, was man essen will, abgerissen bzw. gekaut werden können), ist das Ergebnis des Zufalls. Es hat Wesen ohne eine solche Beschaffenheit, die für ihre Fortexistenz nützlich gewesen wäre, gegeben, aber sie sind eben aufgrund dieses Mangels verschwunden. Nur die anderen haben sich als überlebenstüchtig erwiesen. Es sind die Wesen, denen wir heute begegnen. Die Rolle des Zufalls in der Natur erklärt auch die Tatsache, daß wir heute immer noch „mißgebildeten“ Wesen begegnen.
In mancher Hinsicht steht der darwinistische Evolutionismus der mehr als zwei Jahrtausende vorher entwickelten Konzeption Empedokles’ in bemerkenswerter Weise nahe. Zu denken ist an die Idee, daß die gegenwärtig beobachtbaren natürlichen Seienden das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses sind, daß dieser nicht schnurstracks und mit innerer Notwendigkeit zum Dasein der fraglichen Seienden führt und somit nicht gelenkt, sondern großenteils, wenn nicht gar größtenteils zufällig ist, und daß nur die Seienden, die am besten ihren Lebensbedingungen angepaßt sind, überlebensfähig sind bzw. gewesen sind. Mit Blick auf die Frage der Methode der Naturerkenntnis ist wichtig, daß Empedokles die Existenz der gegenwärtig beobachtbaren Lebewesen nicht als das Werk übernatürlicher – insbesondere göttlicher – Entitäten erklärt, sondern vielmehr als das Produkt natürlicher (irdischer) Faktoren.
5 Naturwissenschaft in der christlichen Welt
Die heidnische Zivilisation der Spätantike machte Platz für eine vom Christentum geprägte Kultur. Die Naturwissenschaft machte in der Spätantike und im Mittelalter keine großen Fortschritte. In der Regel wird der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit mit der Geburt einer „neuen“ Naturwissenschaft, nämlich der Physik, wie sie von Galilei konzipiert wurde, assoziiert, und dies nicht zu Unrecht. Der Durchbruch der „neuen“ Naturwissenschaft ist der Durchbruch der Moderne. Die Höhen, zu denen die Naturwissenschaft seitdem aufgestiegen ist, sind derart, daß, rückblickend auf die Zeit vor dem bahnbrechenden Werke Galileis, man fast unvermeidlich urteilen wird, daß in ihr auf dem Gebiete der Naturwissenschaft kaum Fortschritte gemacht wurden. Dieses Urteil ist nicht falsch, doch sollten aus ihm keine voreiligen, ja irrigen Schlüsse bzgl. der Haltung des Christentums und der Kirche zur Vernunft im allgemeinen und zur Naturwissenschaft im besonderen, speziell im Mittelalter, gezogen werden. Um solche irrige Vorstellungen zu vermeiden, ist es nützlich, einen Blick zu werfen auf die Entwicklung des wissenschaftlichen Betriebs in der Kultur, die vom Christentum gestaltet wurde. Diese Entwicklung steht und muß verstanden werden im breiteren Zusammenhang des Umgangs des Christentums mit dem Problem des Verhältnisses von „Glauben und Vernunft“. Wie der erste Brief des hl. Paulus an die Korinther zeigt, drängte dieses Problem sich dem Christentum bereits in neutestamentlicher Zeit auf (siehe auch Röm. 1 und Apg. 17), und das Problem beschäftigt christliche Denker bis heute. Im folgenden stellen wir das, was wir als die Kernelemente in der Weise, wie im westlichen Christentum das Verhältnis von Glauben und Vernunft oder von Theologie und Philosophie gesehen worden ist 38, und in der Entwicklung der wissenschaftlichen Unternehmung in der vom Christentum beherrschten und gestalteten Kultur betrachten, heraus.
5.1 Die basale Denkform in der klassischen Antike und im Mittelalter als der Hintergrund der Offenheit des Christentums für Vernunft, Philosophie und Naturwissenschaft und der gleichzeitigen Marginalisierung der Naturwissenschaft
Sobald das Christentum sich der nichtjüdischen heidnischen (meistens hellenistischen) Welt öffnete, suchte es die Diskussion mit der zeitgenössischen Philosophie. J. Ratzinger unterstreicht, daß es sich in dieser Hinsicht klar von den heidnischen Religionen abhob, und er schreibt diese christliche Besonderheit der Tatsache, daß im Gegensatz zu ihnen das Christentum von seinem Wesen her immer und überall die Wahrheit gesucht, darum sich der Vernunft geöffnet und dementsprechend seinen natürlichen Partner in der Philosophie gefunden hat, zu 39. Bei den Kirchenvätern stößt man jedenfalls kaum auf eine grundsätzliche und umfassende Ablehnung von Vernunft und Philosophie. Im Gegenteil, Vernunft und Philosophie werden generell in einem positiven Licht gesehen. In den folgenden Jahrhunderten wird das so bleiben 40. Die herrschende Grundüberzeugung ist, daß es keinen echten Widerspruch zwischen Vernunft und (christlichem) Glauben geben kann. Wir begegnen der Ansicht, daß, wenn die Vernunft zu Erkenntnissen, die bestehenden Glaubensaussagen widersprechen, kommt, dies bedeutet, daß die fraglichen Glaubensaussagen auf einer falschen Auslegung der Offenbarung beruhen und diese darum anders interpretiert werden soll, als bisher geschehen ist 41. Das Vermögen der Vernunft, die Wahrheit zu erkennen, wird anerkannt, ebenso aber die Tatsache, daß die Vernunft sich irren kann und ihre Kompetenz nicht unbegrenzt ist, auch und gerade in bezug auf theologische Fragen. Das Eingeständnis der Grenzen der Vernunft folgt jedoch aus der Analyse des Begriffs der Vernunft selbst und nicht aus der Aufnahme eines theologischen Apriori, das der Vernunft fremd wäre. Die affirmative Haltung des Christentums zu Vernunft, Philosophie und Wissenschaft gipfelt in der Scholastik. Des „Rationalismus“ bezichtigt, forderte sie die Verneinung des Vermögens der Vernunft, „autonom“ theologische Aussagen zu machen, durch die Reformation heraus. Bis heute hat die römisch-katholische Kirche konsequent die Lehre von Röm. 1,19-20 42, daß der Mensch zu „natürlicher“ Gotteserkenntnis in der Lage ist, verteidigt, und auf dem ersten vatikanischen Konzil hat die Kirche diese Lehre als definitiv bindend proklamiert. Der Protestantismus hingegen erfährt sie oft als eine Herausforderung an die Theologie, hat aber Vernunft und Philosophie nicht gänzlich aus der Theologie verbannt.
Читать дальше