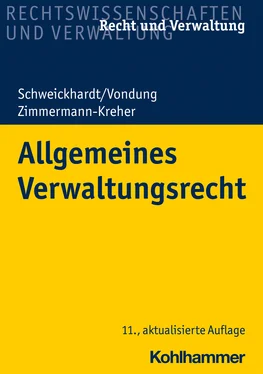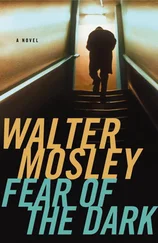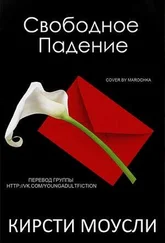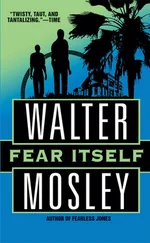124Die Masse der Rechtsetzungsakte erfolgt allerdings in Form der sog. Richtlinien im Sinne des Art. 288 III AEUV.
Beispiele:Richtlinie des Parlaments und des Rates 96/71/EG vom 16.12.1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern (ABl. Nr. 18 S. 1); Richtlinie des Rates 90/313/EWG vom Juni 1990 über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt (ABl. Nr. L 158 S. 56); Richtlinie des Rates 80/779/EWG vom 15.7.1980 über Grenzwerte und Leitwerte zur Luftqualität für Schwefeldioxid (ABl. Nr. L 38 S. 15).
125 a) Grundsätzlich indirekte Wirkung .Bei Richtlinien handelt es sich im Gegensatz zu den Verordnungen zunächst nicht um direkt für EU-Bürger geltendes Recht, sie sind nur gegenüber den Mitgliedstaaten verbindlich und müssen von diesen gem. Art. 288 III AEUV in das jeweilige nationale Recht umgesetzt werden. Dabei sind Richtlinien nur hinsichtlich des Ziels verbindlich, Form und Mittel zum Erreichen des Ziels bleiben den Staaten überlassen. Die Mitgliedstaaten sind allerdings verpflichtet, Formen und Mittel zu wählen, die am besten geeignet sind, Wirksamkeit und Zweck der Richtlinie zu gewährleisten. Die normative Umsetzung von EU-Richtlinien durch Verwaltungsvorschriften kann dabei nicht ohne Weiteres als geeignet angesehen werden. Regelmäßig bedarf es eines förmlichen Gesetzes oder einer Rechtsverordnung (EuGH, EuZW 1991, 440, 442).
Beispiel:Die Umsetzung der Richtlinie über Grenzwerte und Leitwerte zur Luftqualität durch die Technische Anleitung-Luft als Verwaltungsvorschrift war nach Auffassung des EuGH unzulässig, sie musste durch die 22. BImSchV nachgeholt werden.
126Der Umsetzungsauftrag aus Art. 288 III AEUV richtet sich an die Mitgliedstaaten.
In entsprechender Anwendung der Art. 70 ff. GG wird die Umsetzung durch den Bund oder die Bundesländer angezeigt sein. Wird die Umsetzung nicht durchgeführt, so kann die Kommission als Hüterin des Gemeinschaftsrechts gegen den Mitgliedstaat ein Vertragsverletzungsverfahrennach Art. 258 AEUV einleiten (Rn. 145). Das gilt auch bei Versäumnissen der Bundesländer.
127 b) Ausnahmsweise direkte Wirkung .Soweit die Umsetzung einer Richtlinie nicht oder nicht rechtzeitig erfolgt ist, stellt sich die Frage, welches Verhältnis zwischen der Richtlinie und dem nationalen Recht besteht. Aus europarechtlicher Sicht ist die Anwendung nationalen Rechts, das Richtlinien entgegensteht, deren legislative Umsetzung versäumt wurde, unzulässige Rechtsausübung (EuGH, Slg. 1987, 3969, 3977). Der Mitgliedsstaat verhält sich widersprüchlich, wenn er innerstaatliches Recht anwendet, das er hätte an das EU-Recht anpassen müssen. Entsprechendes gilt bei Untätigkeit angesichts nicht vorhandenen nationalen Rechts. Der EuGH hat Richtlinien vor diesem Hintergrund direkte Wirkung zuerkannt. Diese Direktwirkung hat allerdings einige Voraussetzungen. Hinsichtlich der Richtlinie muss die Umsetzungsfrist abgelaufensein, sie muss inhaltlich unbedingtund hinreichend genauerscheinen (W. Schroeder, in Streinz, EUV/AEUV, Rn 91 ff.; EuGH, Slg. 1987, 3969, 3985). Wurde zunächst davon ausgegangen, dass einzelnen Bürgern dazu subjektive Rechte eingeräumt sein und diese auch geltend gemacht werden müssen, so kann als geklärt angesehen werden, dass die nationalen Verwaltungen bei Vorliegen der genannten Kriterien Richtlinien objektivrechtlich anwenden müssen (EuGH, ZUR 1995, 258, 260; Peters, UPR 2001, 172 ff.; s. auch Rn. 92).
Beispiel:Die Umweltinformationsrichtlinie von 2003 wurde von Baden-Württemberg nicht wie vorgeschrieben bis zum 14.2.2005 umgesetzt, sodass sie bis zum Umsetzungsgesetz von 2006 direkt galt.
3.Entscheidungen, Empfehlungen und Stellungnahmen
128Die Entscheidungen nach Art. 288 IV AEUV sind keine abstrakt-generellen Rechtsnormen, sind aber Teil des sekundären Gemeinschaftsrechts. Sie entsprechen dem VAim deutschen Verwaltungsrecht einschließlich der Sonderform der Allgemeinverfügung (vgl. Rn. 236 ff.). Die Entscheidungen richten sich an die Mitgliedstaaten oder an die Bürger. Empfehlungen und Stellungnahmen sind gem. Art. 288 V AEUV nicht verbindlich, können aber die Wirkung von „soft-law“ haben.
D.Verhältnis von Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht
129Angesichts der unterschiedlichen Rechtsetzungsebenen von EU und Mitgliedstaaten kommt es zwangsläufig zu Kollisionen bei der Normsetzung.
130Das Unionsrecht geht dem Recht der Mitgliedstaaten zumindest grundsätzlich vor. Da Unionsrecht und nationales Recht selbstständige Rechtsordnungen sind und die Verträge eine Kollisionsregel wie Art. 31 GG nicht enthalten, ist indessen nur von einem Anwendungsvorrang, nicht aber von einem Geltungsvorrang des Rechts der Union auszugehen. Unionsrechtswidriges innerstaatliches Recht bleibt also gültig. Einen unbeschränkten Vorrang bei einer Kollision von Unionsrecht und deutschem Verfassungsrecht gibt es allerdings nicht. Art. 23 GG ermächtigt nicht dazu, die Identität der deutschen Verfassungsordnung durch Veränderung ihres Gefüges aufzugeben. In einem solchen Falle müsste das Recht der Union zurücktreten, was angesichts der zwischenzeitlichen Ausprägung von EU-Grundrechten durch den EuGH (Rn. 121a) kaum der Fall sein kann (BVerfG, NJW 1974, 1697; 1987, 577).
131Hier stellt sich die Frage, ob den nationalen Verwaltungen eine Verwerfungskompetenz hinsichtlich unionsrechtswidrigen innerstaatlichen Rechts zukommt. Aus europarechtlicher Sicht ist Anwendung nationalen Rechts, das Verordnungen oder Richtlinien entgegensteht, unzulässige Rechtsausübung, ein Mitgliedsstaat verhält sich widersprüchlich, wenn er solches innerstaatliches Recht anwendet (Rn. 127). Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Offensichtlichkeit der Unionsrechtsverletzung eine Verwerfungskompetenz der nationalen Behörden besteht (Fischer, S. 134) – anders als bei einem Verstoß gegen höherrangiges innerstaatliches Recht, hier gibt es nach h. M. keine grundsätzliche Normverwerfungskompetenz der Verwaltung (Rn. 62 ff.).
E.Verwaltungsvollzug des Unionsrechts
132Das Recht der Europäischen Union wird zu einem geringen Teil durch die Kommission als unionseigenem Exekutivorgan und ansonsten durch die Exekutive der Mitgliedstaaten vollzogen.
I.Direkter Vollzug durch die Exekutive der EU
133Unionseigenen Vollzug gibt es nur in wenigen Bereichen, es ist insbesondere zu nennen das Dienstrecht der EU und das Kartell- und Beihilferecht. Diese Art des Vollzugs wird als direkter Vollzug bezeichnet.
1.Materielle Rechtsgrundlagen
134Die dafür notwendigen Rechtsgrundlagen finden sich zunächst in dem jeweiligen sekundären Recht, etwa dem EU-Dienstrecht. Rechtsgrundlagen können aber auch Regelungen aus den Verträgen selbst sein. So kann die Kommission einem Verstoß gegen das Beihilfeverbot des Art. 107 AEUV mit einem Vorgehen nach Art. 108 II AEUV begegnen.
135Handlungsform des Vollzugs ist entsprechend dem deutschen VA im Wesentlichen die Entscheidung im Sinne des Art. 288 IV AEUV (Rn. 128). In Betracht kommen aber auch Vertragsregelungen. Ferner können Stellungnahmen und Empfehlungen zum Vollzug genutzt werden.
136Beim Verwaltungsverfahren muss auf Regelungen des primären und des sekundären Rechts sowie auf allgemeine Rechtsgrundsätze zurückgegriffen werden. Hier finden sich Aussagen zum Antragserfordernis, zu Fristen, zum Untersuchungsgrundsatz, zur Anhörung bzw. zum rechtlichen Gehör, zur Akteneinsicht, zur Vertraulichkeit, zur Begründungspflicht, zu Bekanntgabe und Vollstreckbarkeit (Arndt/Fischer/Fetzer, Rn. 238 ff.).
Читать дальше