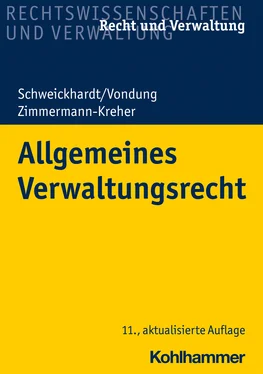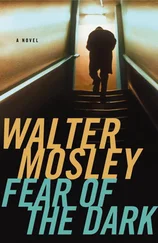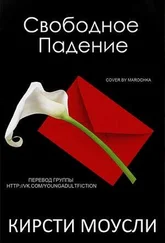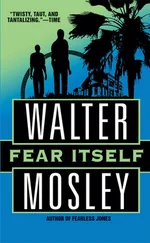III.Einfluss des Europäischen Unionsrechts
92Umstritten ist, inwieweit bei der Durchsetzung des Europäischen Unionsrechts – auch vor deutschen Gerichten – die Schutznormlehre über subjektiv-öffentliche Rechte anwendbar ist oder ob sie zumindest einer Modifikation bedarf.
Grundsätzlich kann sich der Einzelne nach der Rechtsprechung des EuGH unmittelbar auf Bestimmungen in EU-Richtlinien berufen, wenn diese hinreichend bestimmt und inhaltlich unbedingt sind und der Mitgliedstaat die Richtlinie nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat (s. Rn. 127). Dabei soll der Bürger aus diesen unmittelbar anwendbaren Richtliniensubjektive Rechte herleiten können, ohne dass es auf einen zu seinen Gunsten ableitbaren Normzweck ankäme. Vielmehr können nach der Rechtsprechung des EuGHauch bloße Allgemeininteressen ausreichen. Ein wesentlicher Grund für diese Rechtsprechung wird darin gesehen, dass der Bürger „als Hüter der effektiven Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts“ mobilisiert werden soll (so Schoch, VBIBW 1999, 241 m. w. N.; vgl. zum sog. „effet utile“ Rn. 141). Gleichwohl verlangt der EuGH nicht die Popularklage, vielmehr soll zumindest eine „Betroffenheit“ bzw. ein „unmittelbares Interesse“ des Einzelnen erforderlich sein (vgl. auch Rn. 127).
Teilweise versucht die Literaturdieser Aufweichung des Rechtsinstituts des subjektiv-öffentlichen Rechts durch Einflüsse des Unionsrechts entgegenzutreten, indem unionsrechtliche Vorschriften als gesetzliche Ausnahmen nach § 42 II Halbs. 1 VwGO gedeutet werden und so die Klagebefugnis eröffnet wird (Wahl, in: Schoch/Schneider, VwGO, Vorbem. § 42 II Rn. 128).
93Von der Frage, inwieweit bei der unmittelbaren Anwendung von Richtlinien subjektiv-öffentliche Rechte bejaht werden müssen, ist jene zu unterscheiden, inwieweit der nationale Gesetzgeber bei der Umsetzung von Unionsrecht in nationales Recht dazu verpflichtet ist, den vom Unionsrecht Begünstigten subjektiv-öffentliche Rechte einzuräumen.
Nach der Rechtsprechung des EuGH (EuZW 1995, 635 Tz 18) ist dem Einzelnen im nationalen Recht dann ein subjektiv-öffentliches Recht einzuräumen, wenn dies die Zweckrichtung des Unionsrechts vorsieht. Dabei lässt der EuGH auch solche Normzwecke genügen, die nach deutschem Recht als Allgemeininteressen nicht zur Ausbildung subjektiv-öffentlicher Rechte führen würden (vgl. dazu von Danwitz, DVBl. 1998, 421).
D.Vertiefungshinweise und Wiederholungsfragen
I.Vertiefungshinweise
94 Zu A = Rn. 39 ff.
Leisner, Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Recht, JZ 2006, 869 ff.; Katz/Sander, § 2
Zu B = Rn. 58 ff.
Saurer, Die neueren Theorien zur Normkategorie der Verwaltungsvorschriften, VerwArch 97 (2006), S. 249 ff; Ossenbühl, Gesetz und Recht – Die Rechtsquellen im demokratischen Rechtsstaat, HStR V, 3. Aufl. 2007, § 100; Werner, Rechtsquellen des deutschen öffentlichen Rechts, 2020.
Zu C = Rn. 84 ff.
Scherzberg, Das subjektive öffentliche Recht – Grundfragen und Fälle, Jura 2006, 839 ff.; Wolff/Bachof/Stober/Kluth, I § 43; Nettesheim, Subjektive Rechte im Unionsrecht, AöR 132 (2007), S. 333 ff.; Scharl, Die Schutznormtheorie, 2018
1. 95Woran erkennen Sie, ob ein Rechtssatz dem öffentlichen Recht angehört? – Rn. 42 ff.
2. Wofür ist es von Bedeutung, ob die Verwaltung in einem Einzelfall aufgrund öffentlichen Rechts oder aufgrund Privatrechts tätig wird? – Rn. 41
3. Was verstehen Sie unter einem zweistufigen Rechtsverhältnis? – Rn. 56
4. Gehört das StVG zum öffentlichen oder zum privaten Recht? – Rn. 47
5. Die Stadt verwehrt Ihnen den Zutritt zur Stadtbibliothek. Ist ein Rechtsstreit darüber öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur? – Rn. 53, 56
6. Was versteht man unter einem Gesetz im formellen Sinne? – Rn. 69
7. Was ist ein Gesetz im materiellen Sinne? – Rn. 69, 72
8. Welche Vorteile bieten Rechtsverordnungen gegenüber dem Parlamentsgesetz? – Rn. 71
9. Steht Gewohnheitsrecht im Rang unter dem geschriebenen Recht? – Rn. 74
10. Wodurch unterscheidet sich die Satzung von der Rechtsverordnung? – Rn. 72
11. Sind Verwaltungsvorschriften Rechtsnormen? – Rn. 79
12. Worin liegt die Bedeutung von Verwaltungsvorschriften? – Rn. 79–82
13. Was sagt Ihnen der Begriff „Selbstbindung der Verwaltung“? – Rn. 82
14. Welche Rechtsnorm nimmt den höheren Rang ein: die Landesverfassung BW oder die StVO? – Rn. 66
15. Warum bedarf die Exekutive zum Erlass von Rechtsverordnungen einer Ermächtigung durch Parlamentsgesetz? – Rn. 70, 71
16. Worin liegt die Bedeutung der subjektiven öffentlichen Rechte? – Rn. 84, 85
17. Wodurch unterscheidet sich das subjektive öffentliche Recht vom Rechtsreflex? – Rn. 87, 91
18. Was sagt Ihnen der Ausdruck „nachbarschützende Norm“? – Rn. 89
19. Hat ein Bürger ein subjektives öffentliches Recht auf Erlass einer fachaufsichtlichen Weisung, wenn das Regierungspräsidium seine Pflicht zur Fachaufsicht über ein bestimmtes Landratsamt (§ 20 II S. 1 LVG) gröblich verletzt? – Rn. 87
Kapitel 3Grundlagen des Verwaltungsrechts der Europäischen Union
A.Einführung
96Über unmittelbar anwendbare Regelungen des EU-Primär- und Sekundärrechts wie Verordnungen sowie über Richtlinien, die vom nationalen Gesetzgeber in nationales Recht umgesetzt werden müssen, sowie über die Rechtsprechung des EuGH erlangt das Recht der Europäischen Union für das nationale Verwaltungsrecht zunehmende Bedeutung. Kenntnisse über die Struktur der EU, die Rechtsquellen des Unionsrechts sowie zentrale Elemente des Unionsrechts sind daher für die öffentliche Verwaltung auf jeder Ebene unabdingbar.
97Am 7.2.1992 wurde in Maastricht durch Vertrag von ihren Gründerstaaten die Europäische Union ins Leben gerufen. Dieser EU-Vertrag (EUV ),der das Fundament der Union bildet, erhielt 1997 durch den Vertrag von Amsterdam die sogenannte konsolidierte Gebrauchsfassung. Die derzeit 27 Mitgliedstaaten der EU sind Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Das Vereinigte Königreich war Mitglied der EU seit 1973 und trat nach einem Referendum auf der Grundlage des Verfahrens nach Art. 50 EUV mit Wirkung zum 31. Januar 2020 aus (sog. Brexit).
Durch den Vertrag von Lissabon aus dem Jahr 2007 konnte die EU einer grundlegenden Reform unterzogen werden: Aus dem EG-Vertrag (Rn. 98) konnte der „Vertrag über die Arbeitsweise der EU“ werden; die EU hat eine eigene Rechtspersönlichkeit (Art. 47 EUV); der Europäische Rat (Rn. 100) hat Organcharakter bekommen; der Ratspräsident kann auf zweieinhalb Jahre gewählt werden; die Grundrechte-Charta (Rn. 121a) konnte verbindlich werden; ein europäisches Bürgerbegehren wurde eingeführt; das EU-Parlament (Rn. 101) entscheidet regelmäßig im Gesetzgebungsverfahren mit.
Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zum 1.12.2009 bestehen EUV und AEUV in der aktuellen Fassung.
I.Die Säulen der Europäischen Union
98Der EUV hatte in seinem Art. 1 III S. 1 die EU auf drei Säulen errichtet. Die erste Säulebildeten die schon seit den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bestehenden supranationalen europäischen Organisationen der Europäischen Gemeinschaft(EG früher EWG) sowie der Europäischen Atomgemeinschaft(EAG/Euratom), vgl. Arndt/Fischer/Fetzer, Rn. 29 ff. Von diesen war die EG von überragender Bedeutung, so dass nur sie und ihr Gründungsvertrag Beachtung finden sollte. Zweite Säulewar sodann gem. Art. 11 bis 28 EUV die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Dritte Säulewar die Zusammenarbeit nach den Art. 29 bis 43 EUV im Bereich von Polizei und Justiz bei der Verfolgung von Strafsachen (PJZS).Während auf die supranationalen Organisationen als erster Säule der EU von den Mitgliedstaaten Hoheitsrechte übertragen worden sind und sie eine eigene Rechtspersönlichkeit besaßen, war das bezüglich der zweiten und dritten Säule nicht der Fall. Die EU ist vor diesem Hintergrund mehr als nur ein Staatenbund, aber weniger als ein Bundesstaat. Man kann sie als Staatenverbund bezeichnen (BVerfGE 89, 155). Die EU besitzt nunmehr eine eigene Rechtspersönlichkeit.
Читать дальше