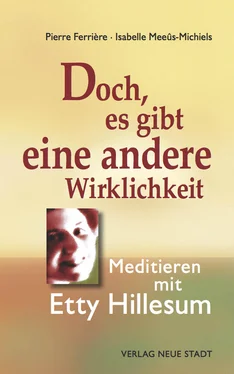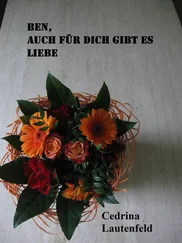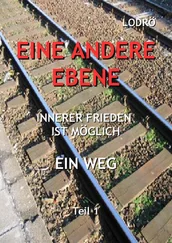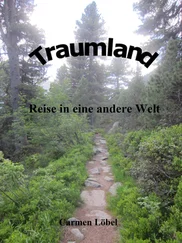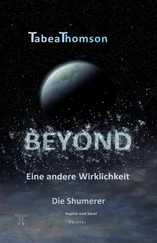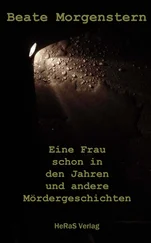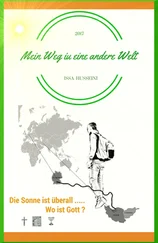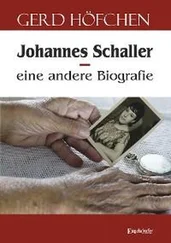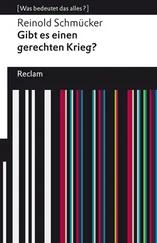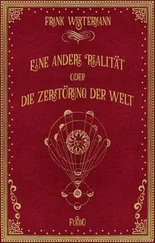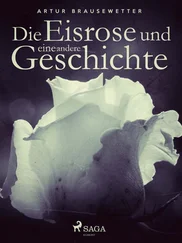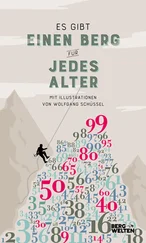Beziehungen zu anderen Menschen können wie eine geheimnisvolle Alchimie wirken. Etty hatte geschrieben: „Ich scheine tüchtig zu sein und mache alles allein, aber ich würde mich so schrecklich gern ausliefern.“
Sich selbst im Griff haben und gleichzeitig die Sehnsucht verspüren, sich auszuliefern – wie passt das zusammen? Wie soll man diesen „zweieinen“ Wunsch, der so widersprüchlich scheint, realisieren? Wie soll man beides leben, ohne wie ein Pendel hin und her zu schwanken, ohne von einem Extrem ins andere zu fallen, ohne von den Gefühlsschwankungen eines unsteten Herzens mal hierhin, mal dorthin getrieben zu werden?
Wenn Etty sich nur ausgeliefert hätte, wenn sie sich ausschließlich Spier und seinem Einfluss auf ihre Persönlichkeit überlassen hätte, so hätte sie sich in der Beziehung mit ihm ihrer selbst entfremdet. Nun hat Etty aber weder ihre Freiheit noch diese Beziehung jemals geopfert. Sie ist in dieser Beziehung als Persönlichkeit gewachsen . Mehr noch: Sie merkt, wie sie mit Spiers Hilfe einen Weg beschreitet, auf dem sie sich jemandem zu öffnen und auszuliefern beginnt, den sie allmählich „Gott“ zu nennen wagt. Die Schönheit ihrer Verbindung mit Spier in aller Härte des Alltags hängt mit diesem inneren Weg eng zusammen.
Ihr Unbehagen angesichts ihres inneren Chaos hat bei Etty Hillesum einen Prozess in Gang gebracht. Das kann ein Anstoß sein, einmal uns selbst zu fragen, womit wir unzufrieden sind, was uns unruhig macht, ob es auch in unserem Leben so etwas wie ein Tohuwabohu gibt.
Kann ich meine Fehler und Schwachpunkte, mein Chaos, meine Schwankungen annehmen als Einladung, diese Punkte anzugehen und an mir zu arbeiten? Mein inneres Durcheinander und meine Blockaden können mich bedrücken, sie können mir aber auch ein Anstoß sein, mich aufzumachen und etwas zu tun. Kann ich mich darauf einlassen? Stelle ich eventuell fest, dass ich jemand suchen sollte, der mich auf diesem Weg begleitet?
Ja zu mir sagen in all meiner Widersprüchlichkeit und angesichts der Feststellung, dass widersprüchliche Kräfte in mir am Werk sind, das verlangt Mut. Etty hat sich ihrer eigenen Befindlichkeit gestellt. Ihr Zeugnis weckt Zuversicht: Wer sich auf einen solchen Weg macht, bleibt nicht allein.
„Ich glaube, dass ich das tun sollte: morgens vor Beginn der Arbeit eine halbe Stunde lang ‚mich nach innen wenden‘, horchen nach dem, was in mir ist. ‚Sich versenken.‘ Man kann es auch als Meditieren bezeichnen. Aber vor dem Wort graut es mir noch ein bisschen. Aber warum eigentlich nicht? Eine halbe Stunde mit mir selbst allein. Es genügt nicht, morgens im Badezimmer nur Arme, Beine und alle andern Muskeln zu bewegen. Der Mensch besteht aus Körper und Geist. Und eine halbe Stunde Gymnastik und eine halbe Stunde ‚Meditation‘ können zusammen ein solides Fundament für die Konzentriertheit eines ganzen Tages bilden. Nur ist das nicht so einfach, so eine ‚stille Stunde‘. Das will gelernt sein“ (VB 35, DDH 35) .
Etty beschließt, das oberflächliche Leben und dieses ständige Sich-im-Kreis-Drehen hinter sich zu lassen. Sie bemerkt, dass sie so vom Alltag in Beschlag genommen ist, dass ihr in ihrer Unruhe alles verschwimmt und sie nicht mehr zu sich selber findet. Doch wie ein Spielball hin und her geworfen zu sein … – ist das eigentlich noch Leben ? Sie will dorthin, wo sie wirklich „zu Hause“ ist, und setzt sich klare Prioritäten: „Morgens vor Beginn der Arbeit eine halbe Stunde lang ‚mich nach innen wenden‘, horchen nach dem, was in mir ist. ‚Sich versenken.‘ Man kann es auch als Meditieren bezeichnen.“
„Meditieren“, das Wort klingt in ihren Ohren noch fremd. Aber sie ist fest entschlossen, es zu versuchen, sich nach innen zu wenden, in sich selbst hineinzuhorchen.
Doch was bedeutet eigentlich dieses „Selbst“? Wie soll man „zu sich selbst“ kommen? Etty blendet keine Dimension ihres Wesens aus: weder den Körper noch das Herz und das, was sie bewegt. Sie wendet sich dem Dschungel psychischer Regungen zu, in dem man sich so oft verliert und der im gängigen Sprachgebrauch mit so vieldeutigen Begriffen wie „Seele“ oder „Geist“ bezeichnet wird.
„Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr kommt“ (1 Thess 5,23), schrieb der Apostel Paulus im Jahr 51 n. Chr. Ausdrücklich erwähnt er Geist, Seele und Leib: eine Einladung, keine Dimension unseres Wesens auszulassen!
Wie hätte Etty auch ihren „Körper“ vergessen können? Er macht sich immer wieder präsent. Etty stellt fest: „Früher dachte ich, die körperlichen Probleme wie Kopfweh, Magenschmerzen, rheumatische Schmerzen wären eine rein physische Angelegenheit. Heute muss ich feststellen, dass sie nicht zuletzt psychisch bedingt sind. Körper und Seele sind bei mir ganz eng verbunden. Wenn bei mir psychisch oder spirituell etwas nicht stimmt, wirkt sich das ebenso auch physisch aus“ (NG 128) .
Sie merkt allmählich, dass ihre Probleme nicht nur physische Ursachen haben: Vieles ist psychosomatischer Natur. Um der engen Verwobenheit von Leib und Seele Rechnung zu tragen, macht sie jeden Morgen im Bad erst einmal eine halbe Stunde Gymnastik, bevor sie dann eine weitere halbe Stunde meditiert. Es ist ihre „stille Stunde“ , die, so schreibt sie, „gelernt sein will“ .
Ettys „Geist“ und „Seele“ sind von vielerlei Gefühlen beherrscht; sie ringt damit und droht zu ertrinken in diesem mächtigen Strudel von Affekten, der auch die Gedanken hinunterziehen kann. Im Einzelnen spricht Etty von Träumereien, von großartigen Gedanken, von blitzschnellen Intuitionen, von Orgien inneren Lebens … Es ist wie ein seelisch-geistiger Mahlstrom, ein gefährlicher Gezeitenstrom voller Strudel, der sie mitreißt und aller Orientierung beraubt, ein Ozean, der sie jederzeit verschlingen könnte.
So nimmt sie sich jeden Morgen eine Stunde Zeit für einen „inneren Großputz“. Langsam, aber sicher gelingt es ihr, die „verstopfte Seele“ zu befreien und wieder Klarheit zu gewinnen. Erst müssen sich die Dinge absetzen, die ihre Seele trüben – wie beim Dekantieren eines guten alten Bordeaux …
Auch wir werden manches Mal von einem Gefühlswirrwarr überrollt; gestresst, wie wir häufig sind, merken wir gar nicht, wie es uns den Halt verlieren lässt. Oder denken wir an die überbordenden Informationen, die geradezu über uns hereinbrechen. Mehr denn je verspüren wir heute das vitale Bedürfnis, auf Distanz zu all diesen Eindrücken und Emotionen zu gehen, Abstand zu gewinnen, loszulassen und zu entspannen.
Etty schafft es dank ihrer „Aufräumaktion“ mit der Zeit, den Schutt wegzuräumen, der sie innerlich blockiert und ihr „die Seele verstopft“. Sie hat dabei den Eindruck, am Rand „eines tiefen Brunnens“ zu stehen, für den sie den Namen „Gott“ wählt (VB 55) .
„Nur ist das nicht so einfach, so eine ‚stille Stunde‘. Das will gelernt sein … Der Zweck des Meditierens sollte sein: dass man sich innerlich zu einer großen Ebene ausweitet, ohne all das heimtückische Gestrüpp, das die Aussicht behindert. Dass etwas von ‚Gott‘ in einem erwächst, wie auch in der Neunten von Beethoven etwas von ‚Gott‘ enthalten ist. Dass auch eine Art ‚Liebe‘ entsteht, keine Luxus-Liebe von einer halben Stunde, in der es sich voller Stolz auf die eigenen erhabenen Gefühle herrlich schwelgen lässt, sondern eine Liebe, mit der man in der kleinen alltäglichen Praxis etwas anfangen kann“ (VB 36, DDH 35f) .
Hätte Etty sich nicht einfach in die Bibel hineinvertiefen können, die sie durch Spier kennen- und schätzen gelernt hatte? Mit feinem Gespür nimmt sie wahr, dass dieser Augenblick für sie noch nicht gekommen ist; sie wäre Gefahr gelaufen, die Bibellektüre noch zu „verkopft“ anzugehen.
Читать дальше