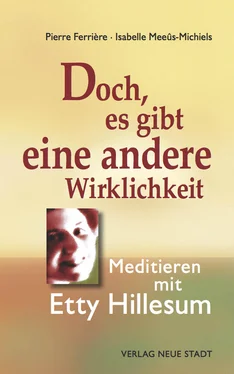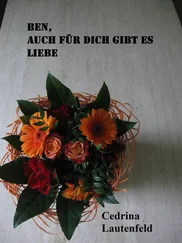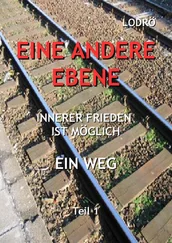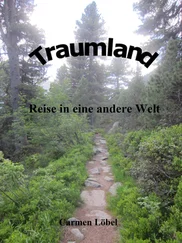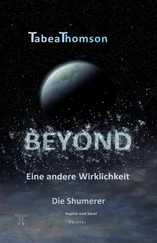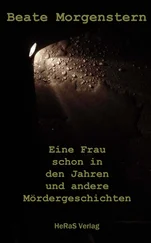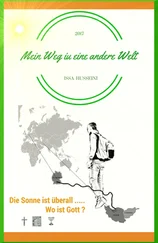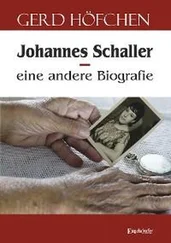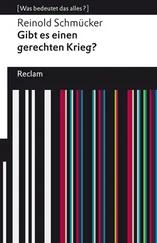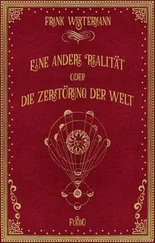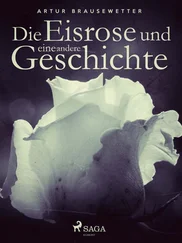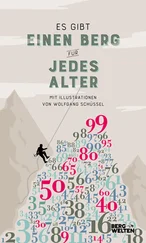Ihre Bemühungen, zumindest ihren Eltern und ihrem Bruder Mischa, die ebenfalls in Westerbork interniert waren, dieses Schicksal zu ersparen, waren vergeblich. Etty, Mischa und ihre Eltern wurden am 7. September in einen Deportationskonvoi „verladen“, zusammen mit 983 weiteren Personen, von denen nur acht überlebten. An jenem 7. September hat Etty Hillesum ihre letzte Karte durch einen Schlitz im Waggon auf das Schotterbett geworfen. Am 30. November 1943 starb sie in Auschwitz. Binnen weniger Monate erlitt ihre gesamte Familie dasselbe Schicksal, auch Jaap blieb nicht verschont.
In Westerbork hatte Etty weiter Tagebuch geschrieben. Hastig steckte sie die letzten Aufzeichnungen in den Beutel, den sie im Zug mitnehmen konnte. Diese Notizen sind unwiederbringlich verlorengegangen. Die zuvor geschriebenen Hefte hatte sie am 5. Juni einer Freundin übergeben können, unmittelbar vor ihrem letzten Aufbruch nach Westerbork. Auf verschlungenen Wegen sind sie nach Jahrzehnten ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Das letzte Heft endet mit dem Eintrag vom 13. Oktober 1942; aus der Zeit danach bis zu ihrer Deportation nach Auschwitz haben wir eine Reihe von Briefen, die Etty an verschiedene Leute, mit denen sie seit den Aufenthalten in Westerbork befreundet war, geschrieben hat.
Dies sind, grob skizziert, die äußeren Eckpunkte ihres Lebens. Im Folgenden werden wir versuchen, Einblick zu gewinnen in innere Entwicklungen, in das, was Etty Hillesum bewegte, und uns mitnehmen lassen ins Gespräch mit jenem geheimnisvollen Gott, der im Buch der Weisheit „Freund des Lebens“ genannt wird (vgl. 11,26).
EIN EINZIGARTIGER INNERER WEG
Meditieren mit Etty Hillesum, dies mag manchen ein wenig gewagt erscheinen, war sie doch keine Christin. Aber ihr spiritueller Weg ist so bemerkenswert, ja überwältigend, dass es mehr als gerechtfertigt ist, sich von ihr inspirieren zu lassen. Von einem anfänglich ganz vagen, kaum bewussten religiösen Empfinden fand sie zu einem Leben in der fast ununterbrochenen Präsenz Gottes: „Es ist, als hätte sich etwas in mir einem beständigen Gebet überlassen: ‚Es betet in mir‘, selbst wenn ich lache oder scherze.“
Aufgrund der Originalität ihrer Erfahrung und ihrer einzigartigen Weise, darüber zu sprechen und davon Zeugnis zu geben, hat man Etty Hillesum als „nicht klassifizierbar“ bezeichnet. Es wurde gesagt, in ihren Texten scheine der Name Gottes „aller Tradition beraubt“. Doch auch wenn ihr innerer Werdegang wie ein persönlicher Sonderweg erscheint, auch wenn sie sich nie einer Kirche oder einem religiösen Bekenntnis angeschlossen hat, so heißt das nicht, dass sie sich unbeeinflusst von religiösen Traditionen entwickelt hätte. Sie war Jüdin, das Enkelkind eines Großrabbiners, und auch wenn sie offenbar kaum in der Religion ihrer Väter erzogen worden ist, so wurde sie sich doch ihres Judentums sehr bewusst; für sie war es ein fester Bezugspunkt. Gerade das hat sie ja bewogen, sich ihrem Volk tief verbunden zu fühlen und sein Leid zu teilen.
Zudem war Etty in Kontakt mit christlichen Freunden; sie las große christliche Autoren wie Augustinus, Dostojewski u. a. Die Bibel hatte sie stets zur Hand und im Herzen, regelmäßig las sie darin, sie zitierte öfter Worte aus dem Ersten wie dem Neuen Testament. Was anfänglich Neugierde oder Sympathie für dieses christliche Erbe gewesen sein wird, wurde mit der Zeit zu einer tiefen Nähe. Doch darf daraus keineswegs abgeleitet werden, dass sie sich den christlichen Glauben zu eigen gemacht hätte.
Generell sollte man sich davor hüten, Ettys Zeugnis in irgendeiner Weise zu vereinnahmen. So sehr es der historischen Wahrheit und ihrem eigenen Bekunden entspricht, dass sie eine Beziehung zu jüdischen und christlichen Traditionen hatte, so ist gleichzeitig ihre Unabhängigkeit gegenüber jeder religiösen Institution, ob Kirche oder Synagoge, hervorzuheben. Nicht zuletzt diese Unabhängigkeit ist typisch für ihren überraschenden, unkonventionellen inneren Weg. Auch alle Spekulationen, „was wohl aus Etty geworden wäre, wenn sie die Schoah überlebt hätte“, verbieten sich: Sie gehören ins Reich der Fabeln.
Vielleicht ist es dieser innere Weg, diese „spirituelle Initiation“ an den Rändern der großen Traditionen, die sie vielen unserer Zeitgenossen so nahe sein lässt. Denn viele Menschen leben heute ihr inneres Suchen in respektvoller Distanz zu den „etablierten“ Religionen.
Als Etty am 5. Juni 1943 Amsterdam für immer in Richtung Westerbork verließ – ohne Rückfahrkarte sozusagen –, war unter ihren persönlichen Habseligkeiten eine Korbtasche mit dem Koran und dem Talmud … Als sie am 7. September 1943 den Waggon Nr. 12 des Todeszugs Richtung Auschwitz bestieg, war in dem eilig gepackten Beutel eine Bibel …
„Mach den Raum deines Zeltes weit, spann deine Zelttücher aus, ohne zu sparen. Mach die Stricke lang und die Pflöcke fest“, heißt es beim Propheten Jesaja (54,2). Ettys Leben ist ein leuchtendes Beispiel für ein solches „Weitwerden“ und „Sich-Festmachen“.
Etty Hillesum hätte wohl nur schmunzeln können bei der Vorstellung, einmal zu einer Art „geistlicher Wegbegleiterin“ zu werden, die einführt ins Gespräch mit Gott. Gewiss, von ihren Gebetsworten können wir viel lernen. Viele Stellen ihrer Aufzeichnungen verdienten, in eine Anthologie aufgenommen zu werden: Es gibt Texte von atemberaubender Schönheit und einem herzerweiternden großen Atem … Auf einige solcher Stellen werden wir eingehen. Doch zunächst einige Hinweise zu einer sehr grundsätzlichen Frage, die bei der Lektüre ihrer Aufzeichnungen wach wird: Wo beginnt und wo endet eigentlich Ettys Beten?
Wenn Etty sagt, sie wolle in aller Einfachheit verfügbar sein und selbst der „Kampfplatz“ sein, wo die Fragen und Nöte ihrer Zeit zum Frieden finden, betet sie da?
Wenn sie dem „ewigen Mond“ ausgefallene Reden hält, wenn sie mehr schlecht als recht versucht, irgendwie ihr inneres Auf und Ab zu bestehen, betet sie da?
Wenn Etty sich dem Risiko aussetzt, den verwirrenden, bedrängenden Fragen, die sie manchmal überkommen, nicht auszuweichen; wenn sie wagt, mit einem zum engen Freund gewordenen Mann die „erfüllende“ Freude über eine innige Beziehung zu genießen, ist das auch eine Form ihrer Gottesbeziehung? Betet sie da?
Wenn sie inmitten des Ratterns der Schreibmaschinen im Schreibsaal kurzzeitig alles um sich herum vergisst, um sich zu sammeln, betet sie da?
Wenn sie sich daranmacht, die Worte festzuhalten, die eine hochschwangere Frau unmittelbar vor der Deportation mit leiser, müder Stimme ausspricht, betet sie da?
Verfügbar sein, suchen, wie man leben soll, sich aussetzen, sich entziehen, da sein … – ist das Beten? Und weiter: weinen, sich freuen, zweifeln, tanzen, warten, singen, kämpfen, atmen, schreiben, geboren werden … – ist das Beten?
Eines Tages wurde Etty von einem unwiderstehlichen Impuls erfasst, der sie selbst überrascht hat: Spontan kniet sie nieder auf dem Sisalteppich im Bad, das Gesicht zwischen ihren Händen. Sie durchlebt eine innige Erfahrung, von der zu sprechen sie sich scheut. Das Wort „Gebet“ wirkt allzu blass und fad, um diese Geste des Niederkniens zu beschreiben; der bloße Gedanke an diesen Moment rührt „an das Intimste des Intimsten“ , das ein Mensch erleben kann, wie sie sagt (NG 334) . Ja, gibt es eigentlich etwas „ so Intimes, etwas so Inniges wie die Beziehung eines Menschens mit Gott“ ?
„Das Intimste des Intimsten“ , diese Formulierung mit doppeltem Superlativ ist Ettys Versuch, das durch eine unbeschreibliche Erfahrung „geheiligte“ Herz sprachlich zu fassen. Zögernd und mit aller Vorsicht lässt sie diesen Moment anklingen, in der Furcht, die unzulänglichen Worte könnten ihn seiner Schönheit berauben.
Читать дальше