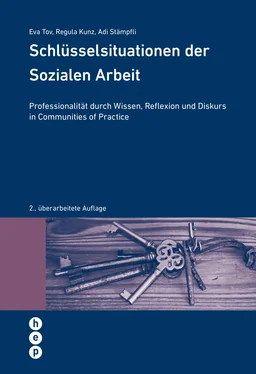Mit dieser Geschichte unserer CoP möchten wir verdeutlichen, dass die Ideen in diesem Buch, wie es Freire im Motto zu diesem Teil über das »Wort« schreibt, im Zusammenspiel von Reflexion und Aktion entstanden sind. Ganz im Sinne Freires haben wir diese radikale Interaktion, die uns und darüber unsere Welt verändert hat, erfahren. Im stetigen Wechselspiel von Ausprobieren und Reflektieren haben wir eine Veränderung der Welt im Kleinen erreicht.
Nur durch dieses reflexive Zusammenspiel von Handeln und Wissen gelingt die Relationierung von Theorie und Praxis. Sie kann weder rein theoretisch noch rein praktisch gestaltet werden. Professionalität kann in unserem Verständnis durch den Diskurs über die Bedeutung von Wissen und Praxis (Handeln) gefördert werden. Wir möchten die Leserinnen und Leser ermutigen, selbst auf die Suche nach Antworten zu gehen und dabei auch Neues auszuprobieren. Wir hoffen, dass die im Buch enthaltenen Ideen dazu anregen.
The case is not in the book
Donald A. Schön
1
Einleitung
Der einleitende Teil gibt eine erste Übersicht zum Modell »Schlüsselsituationen« mit den beiden Aspekten Arbeit mit und Diskurs über Schlüsselsituationen. Wir verorten das Modell im Kontext des Diskurses zur Relationierung von Theorie und Praxis und vor dem Hintergrund der Hochschulentwicklung. Schließlich geben wir eine Übersicht zu den einzelnen Teilen des Buches und Lesehinweise.
Überblick
Eine grundlegende Frage jeder Profession und somit auch der Sozialen Arbeit ist, was Professionalität ausmacht und wie diese gefördert werden kann. Wir geben in diesem Buch mit dem Modell »Schlüsselsituationen der Sozialen Arbeit« Antworten auf diese Fragen.
Der Berufskodex der Sozialen Arbeit verpflichtet die Profession, ihre Erklärungen, Methoden und Vorgehensweisen auf wissenschaftlich fundierte Grundlagen zu stellen (AvenirSocial, 2010; siehe auch www.avenirsocial.ch/cm_data/EthikprinzSozArbeitIFSW.pdf). Gleichzeitig sind Entscheidungen nach Abwägen aufgrund von ethischen Grundsätzen zu fällen. »Professionell handeln« bedeutet demnach, wissens- und wertebasiert zu handeln. Im Reflexionsmodell »Arbeit mit Schlüsselsituationen« streben wir beides an, indem die Verbindung von Wissen und Handeln anhand von Situationen der Sozialen Arbeit unter Berücksichtigung von situativen Kontexten geschieht und die Situation mit auf Werten basierenden Qualitätsstandards reflektiert wird. Dabei wird die Bedeutung von Theorie und Praxis in Communities of Practice (CoPs) ausgehandelt. Der »Arbeit mit Schlüsselsituationen« ist der Hauptteil dieses Buches gewidmet.
Wir wagen aber auch einen Blick in die Zukunft, denn es reicht nicht aus, wenn Professionelle der Sozialen Arbeit situativ reflektieren. Der Berufskodex weist nämlich auch darauf hin, dass Wissen zu teilen und hinsichtlich der Qualität zu überprüfen ist (AvenirSocial, 2010). Wie dies geschehen kann, stellen wir anhand unserer Perspektive einer virtuellen CoP rund um eine offene Plattform vor. Darauf wird das kasuistische Wissen, das in Schlüsselsituationen dokumentiert wird, veröffentlicht. Die Plattform ermöglicht damit einen fachlichen Diskurs über Schlüsselsituationen und trägt so durch die Relationierung von Wissen und Handeln über die Grenzen von scientific und professional communities hinaus zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit bei.
Bevor wir unser Modell vorstellen, wollen wir in dieser Einleitung auf den gegenwärtigen Diskurs zur Relationierung von Theorie und Praxis als konstitutives Problem der Profession eingehen. Wir zeigen die Entwicklungen der Hochschullandschaft auf und illustrieren, wie diese die Entstehung des Modells »Schlüsselsituationen« beeinflusst haben. Schließlich stellen wir die einzelnen Teile des Buches kurz vor.
Relationierung von Theorie und Praxis
Ganz im Sinne unseres Modells, bei dem wir von erlebten Situationen ausgehen, wollen wir den Diskurs zur Relationierung von Wissen und Handeln mit einer Alltagsgeschichte beginnen: Wenn wir ein Problem mit der Bedienung des Fernsehers haben, versuchen wir es zu lösen, indem wir verschiedene Funktionen ausprobieren. Falls dies nicht zum Ziel führt, lesen wir die Bedienungsanleitung, manchmal funktioniert das, manchmal auch nicht. Dieses – zugegebenermaßen – alltägliche Problem kann durchaus auf diese Weise gelöst werden. Wir halten uns dabei an ein situativ genutztes technisch-rationales Verständnis von Problemlösung. Auf die Soziale Arbeit übertragen, würde dies bedeuten, dass in einer herausfordernden Situation auf der Basis von Erfahrungen Lösungen gesucht werden. Man probiert mal aus, ob bewährte Interventionen auch in der aktuellen problemhaften Situation zur Lösung verhelfen. Wenn dies nicht genügt, konsultiert der Sozialarbeiter oder die Sozialpädagogin vielleicht Kolleginnen, Mitarbeiter oder einen Fachartikel, um sich die Studienresultate einer ähnlich gelagerten Problemstellung zu vergegenwärtigen. Er oder sie versucht dann, die so gewonnenen Erkenntnisse auf den Fall zu beziehen. Aber im Unterschied zu Fernsehgeräten, bei denen eine begrenzte Anzahl vergleichbarer Modelle auf dem Markt sind, sind Adressatinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit alle einzigartig und somit auch jeweils die Problemstellungen. Für eine professionelle Tätigkeit stellt sich die Herausforderung im Grundsatz ähnlich dar, jedoch viel komplexer. Es lassen sich aber keine Anleitungen in der Literatur finden, wie wir in einer spezifischen Situation vorzugehen haben, denn »the case is not in the book«, wie das Schön (1983, S. 5) so prägnant ausdrückt.
In der inzwischen nicht mehr aktuellen Diskussion zum Verhältnis von Theorie und Praxis im Sinne eines Transfers (Dewe, 2012; Eugster, 2000) wurde Professionalität in einen direkten Zusammenhang mit Profession gesetzt. Dieser Zusammenhang war unter der strukturellen Perspektive, nach welcher der Sozialen Arbeit höchstens der Rang einer Semiprofession zukommt, insofern kritisch, als die Professionalisierbarkeit dieses Berufes, dem es an Autonomie und großen Entscheidungsspielräumen mangelt, als fraglich angesehen wurde (Heiner, 2004). Nach der handlungstheoretischen Perspektive von Schütze (1992) steht das kompetente, an berufsethischen Standards ausgerichtete Handeln der Professionellen im Sinne der zu erreichenden Wirkungen im Zentrum. Unter dieser Optik ist sehr wohl Professionalität denkbar und Professionalisierung eine mögliche anzustrebende Größe. Als professionelles Handeln wird dabei in der neueren Diskussion vor allem die Fähigkeit verstanden, wissenschaftlich fundiert in einer komplexen, von Heterogenität geprägten Praxis und unter Unsicherheit lösungsorientiert zu handeln (Heiner, 2004).
Die Anwendung wissenschaftlichen Wissens in der Praxis hat dabei im Laufe der Zeit eine Veränderung erfahren. Während zu Beginn von »Transfer« des wissenschaftlichen Wissens in die Praxis gesprochen wurde, ging die Fachwelt später dazu über, die »Transformation« von Wissen zur Nutzung in der Praxis zu betonen. Dies hat schließlich zum Begriff der »Relationierung« von unterschiedlichen Wissenstypen geführt (von Spiegel, 2008, S. 58). Unter Relationierung wird dabei verstanden, dass wissenschaftliches Wissen von in der Praxis Tätigen selektiv aufgenommen, auf die konkrete Problemstellung hin interpretiert wird und schließlich mit beruflichem Erfahrungswissen verschmilzt und sich so zu einem neuen Typ von Wissen wandelt, dem Professionswissen (Dewe, 2012).
Das Grundproblem bei der Relationierung von theoretischem und praktischem Wissen ist die Unterschiedlichkeit von Wissenschaft und Praxis, die je eigenen Gesetzmäßigkeiten und Logiken folgen und von daher inkompatibel sind. Während die Wissenschaft der Wahrheitsfindung dient und dabei einem Begründungszwang unterliegt, sind die Referenzkriterien der Praxis Wirksamkeit und Handlungszwang (von Spiegel, 2008). Vor diesem Hintergrund sind die regelmäßig konstatierten Enttäuschungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Unfähigkeit der Praktikerinnen und Praktiker, sich an das in der Ausbildung vermittelte Wissen zu erinnern und es im Berufsalltag bewusst und nutzbringend anzuwenden, ein Resultat falscher Prämissen und Erwartungen. Andererseits entkräftet diese Diagnose nicht den Vorwurf von Staub-Bernasconi (1998, S. 47), wenn sie kritisiert:
Читать дальше