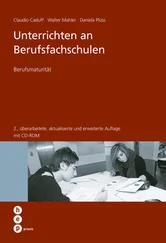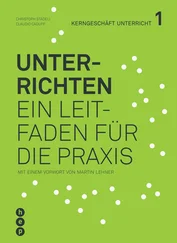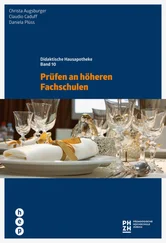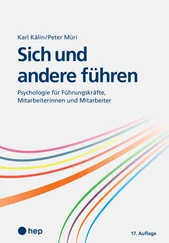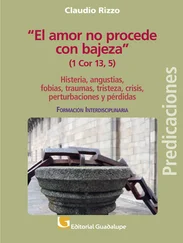–Maßnahmen der Verhaltenskontrolle, die sich in Studien bei jüngeren Lernenden stets als besonders effizient herausgestellt haben, dürften bei Lernenden der Sekundarstufe II weniger wirksam sein. Dies zeigen ähnliche Befunde bei Eder (2004). Günstige Effekte scheinen aber auch bei älteren Lernenden klare Verhaltenserwartungen, Aufmerksamkeit für die Vorgänge im Klassenzimmer und das Anerkennen konstruktiver Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler zu haben.
Klassenführung und Gesundheit
Probleme mit der Klassenführung führen, so zeigen verschiedene Forschungen zur Gesundheit von Lehrkräften, zu Belastungen im Berufsalltag und zu Burnout (bspw. Farber 1991; Brouwers & Tomic 1999; Ghanizadeh & Jahedizadeh 2015, Gaertner 2016) und dazu, dass Burnout sowie Frühpensionierungen auf der Liste der genannten Gründe ganz oben zu finden sind. Es zeigen sich Argumentationslinien, wie die Beziehungen zwischen ineffizienter Klassenführung und Lehrergesundheit aussehen:
–Nach Stähling (2000) kann bei der Klassenführung ein regelrechter Aufschaukelungsprozess in Gang gesetzt werden. So führt ineffiziente Klassenführung zum Sinken der Aufmerksamkeitsrate der Lernenden. Die führt zu Erhöhung des Stresses der Lehrkraft, was wiederum dazu führt, dass es zum Sinken beziehungsweise zu Inkonsequenzen der Handlungsregulation kommt.
–Es zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen Burnout und der erlebten Diskrepanz, die sich aus dem zum Teil ernüchternden Berufsalltag und den teilweise idealistischen Erwartungen über die Vorstellung, was eine gute Lehrkraft ist, ergeben (vgl. Byrne 1999). Noch schlimmer wird es, wenn Lehrkräfte in ihren Klassen keine Ordnung mehr durchsetzen können, gleichzeitig aber annehmen, ihre Kolleginnen und Kollegen hätten überhaupt keine Probleme damit (vgl. Brouwers & Tomic 1999).
Enttäuschungen sind also vorprogrammiert, da im unterrichtlichen Kontext viele widersprüchliche Handlungserwartungen, die jeweils für sich gesehen ihre Berechtigung haben, aufeinandertreffen (vgl. Haag 2018).
Führung und Struktur
Wie viel Struktur und wie viel Führung ist im Unterricht überhaupt zulässig? Meyer (2004, S. 38) beantwortet die Frage wie folgt: «Durch eine klare Strukturierung des Unterrichts werden die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen gelegt. Dabei hat der Lehrer zunächst die führende Rolle. Mit der Zeit sollen die Schülerinnen und Schüler aber lernen, diese Aufgabe gemeinsam mit ihren Lehrern zu bewältigen». Daraus lassen sich acht Tipps für den Unterricht ableiten:
–Klare Ziele formulieren: Die Lernenden müssen zu jedem Zeitpunkt wissen, was zu tun ist. Zu Beginn des Unterrichts werden die Ziele bekannt gegeben. Durch klare und gut verständliche Zielformulierungen ergibt sich für die Lehrkraft und für die Lernenden ein roter Faden durch die Unterrichtsstunde oder den Schultag. Der «Fahrplan» wird schriftlich festgehalten und ist für die Lernenden jederzeit sichtbar.
–Bedeutung der Inhalte hervorheben: Die Lernenden interessieren sich dann besonders für ein Unterrichtsthema, wenn sie dessen Bedeutung für sich selbst erfassen können. Bezugspunkt ist, wenn immer möglich, die Lebens- und/oder Arbeitswelt der Lernenden. Mithilfe von konkreten Beispielen aus dem Alltag und mit stufengerechten und aktuellen Unterrichtsmaterialien können die Lernenden motiviert werden, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Lernende fordern von den Lehrkräften außerdem einen lebensweltlichen Bezug zum Thema (vgl. Pfiffner & Walter-Laager 2009).
–Hektik vermeiden: Hektik entsteht immer dann, wenn die Lehrkraft zu viel Stoff in eine Unterrichtsstunde packt und dann selbst unruhig und nervös wird, weil nicht alles behandelt werden kann oder sich große Wissenslücken auftun. Weniger ist manchmal mehr – so lässt sich die notwendige Ruhe in den Unterricht bringen, die als Basis für die weiteren gemeinsamen Lernschritte von großer Bedeutung ist.
–Zeitmanagement: Unterrichtszeit soll vor allem «Lernzeit» sein! Organisatorische Belange wie zum Beispiel Kontrolle der Anwesenheit oder Informationen zu Schulanlässen dürfen zeitlich nicht ausufern, sondern sollen kurz und klar eingebracht werden. Gibt es beispielsweise erst knapp vor der großen Pause ein Zeitfenster für den «Organisationkram», so beschränken sich die Lernenden in der Regel auf die wesentlichen Rückfragen.
–Erfolge ermöglichen: Die Lernenden erhalten regelmäßig eine sachbezogene Rückmeldung zu ihren Leistungen. Feedback ermöglicht ihnen, ihr Verhalten zu verändern. Wohldosiertes Lob für eine sehr gute Arbeit fördert die Motivation und ist Garant für weitere Erfolge.
–Humor und Freude: Humor, Freude und Zuversicht sind unersetzbare Pfeiler eines guten Unterrichts. Humor schafft Vertrauen, fördert die soziale Interaktion und wirkt auf allen Ebenen motivierend. Aber Achtung, die Lehrkraft muss immer authentisch bleiben. Sie muss selbst Freude am Inhalt und am Umgang mit den Lernenden haben und Zuversicht ausstrahlen. Wer mit Freude unterrichtet und Sinn für Humor beweist, wird von den Lernenden geschätzt und gehört letztlich zu den erfolgreichen Lehrkräften.
–Anforderungen stellen: Die Lernenden wollen im Unterricht gefordert und gefördert werden. Sie wollen ihr Wissen erweitern und etwas Neues lernen. Deshalb ist es wichtig, die Aufträge so zu formulieren, dass die Lernenden herausgefordert werden, selbst etwas entwickeln müssen und das anwenden können, was sie im Unterricht bereits gelernt haben. Neben Kenntnisaufgaben sollen die Lernenden deshalb vor allem häufig Anwendungs- und Problembearbeitungsaufgaben erhalten.
–Störungen im Unterricht (sofort) angemessen ansprechen: Lehrkräfte sollen (sofort) auf mögliche Störungen reagieren, und zwar angemessen. Wie bereits erwähnt, gilt das Motto «den Ball flach halten». Vereinbarte Maßnahmen müssen allerdings konsequent umgesetzt werden, sonst wirkt die Lehrkraft innerhalb kurzer Zeit unglaubwürdig und untergräbt dadurch ihre Führungsfunktion.
Für den Unterricht und auch für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern spielt die Klassenführung eine zentrale Rolle (vgl. Gaertner 2016, S. 29). Wie sich zudem gezeigt hat, gehört die Klassenführung «zu den herausfordernden Aufgaben von Lehrkräften, die zu subjektivem und objektivem Belastungserleben führen kann» (ebd., S. 7). Von einer gelingenden Klassenführung profitieren Lernende wie Lehrende also gleichermaßen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.