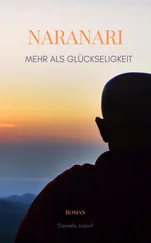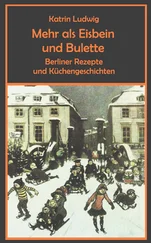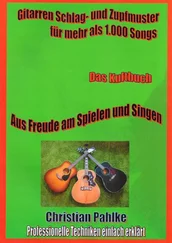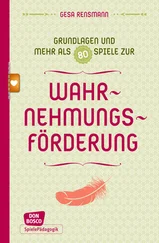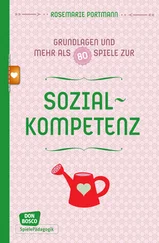Leitmedienwechsel-Reaktion -1: Gegensteuern!
Einfacher einzuordnen sind die Reaktionen derer, die in der Digitalisierung vor allem negative Folgen für Schule und Bildung sehen und entsprechend gegensteuern möchten. Oft wird ein idealisiertes Bild der bisherigen Schule dem Schreckensszenario einer vollständig digitalisierten Lebenswelt gegenübergestellt. Gemäß dieser Argumentation ist es die Aufgabe der Schule, eine möglichst von der Digitalisierung unberührte Umgebung zu erhalten  a1192. In der Schule sollen diejenigen Kompetenzen gefördert werden können, die durch die Digitalisierung bedroht werden. Vertreterinnen und Vertreter dieser Position sehen die gesunde Entwicklung von Kindern durch digitale Medien bedroht, dies insbesondere in der Schule. Häufig sind Aussagen der folgenden Art zu hören:
a1192. In der Schule sollen diejenigen Kompetenzen gefördert werden können, die durch die Digitalisierung bedroht werden. Vertreterinnen und Vertreter dieser Position sehen die gesunde Entwicklung von Kindern durch digitale Medien bedroht, dies insbesondere in der Schule. Häufig sind Aussagen der folgenden Art zu hören:
› Kinder benötigen Primärerfahrungen,computervermittelte, virtuelle Erfahrungen können diese nicht ersetzen und würden die Kinder nur verwirren und überfordern.  a295
a295
› Kinder benötigen Bewegung,und Computernutzung führt zu phlegmatischem Herumsitzen und damit zu Haltungsschäden und Übergewicht.
› Kinder benötigen eine geschützte Kindheit,die sie vor gewalthaltigen und pornografischen medialen Einflüssen der rohen Erwachsenenwelt abschirmt.
› Kinder müssen vor falschen Anreizen geschützt werden.Digitale Medien fördern Konsumismus und liefern zu leichte Erfolgserlebnisse, was die Anstrengungsbereitschaft und damit die Schulleistungen senkt.
› Kinder müssen selbst denken lernenund sollen dies weder dem Computer überlassen noch sich mit oberflächlichen Antworten aus dem Internet zufriedengeben.
Eine konstruktive Diskussion ist mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Position manchmal schwierig, vor allem dann, wenn eine absolute Entweder-oder-Position vertreten wird, die mitunter auch sektiererische Züge annehmen kann. Kapitel 7 beschäftigt sich intensiver mit der Frage, wie mit dieser destruktiven Pauschalkritik umgegangen werden kann.
Leitmedienwechsel-Reaktion 1: Integration in alle Fächer
Während dies die ersten beiden Reaktionsweisen verneinen, sind sich die Vertreter der nächsten Positionen darin einig, dass der Leitmedienwechsel ein Thema darstellt, das die Schule betrifft. Es gibt allerdings unterschiedliche Auffassungen darüber, wie stark sich die Schule vom Leitmedienwechsel beeinflussen lassen soll. Die derzeit verbreitetste Position geht davon aus, dass die Digitalisierung alle Lebensbereiche betrifft und deshalb auch in alle Schulfächer integriert werden sollte  a1181. Die Digitalisierung wird als Thema der Allgemeinbildung gesehen. Dabei reichen die Begründungen von einem eher sanften »Es genügt, wenn sich alle Fächer etwas mit digitalen Themen beschäftigen« bis zum stärkeren »Da der Leitmedienwechsel überall stattfindet, müssen entsprechende Themen auch überall integriert werden!«. Die integrative Position ist bereits in vielen aktuellen Lehrplänen zu finden. Oft wird dabei in Lehrplanzusätzen definiert, was im Bereich der Digitalisierung zu vermitteln sei, ein eigenes Fach oder dafür reservierte Unterrichtsstunden sind dafür aber nicht vorgesehen. In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zeigt sich diese Position darin, dass keine entsprechend expliziten Ausbildungsmodule mit digitalen Themen vorgesehen sind, sondern diese in andere Module integriert werden.
a1181. Die Digitalisierung wird als Thema der Allgemeinbildung gesehen. Dabei reichen die Begründungen von einem eher sanften »Es genügt, wenn sich alle Fächer etwas mit digitalen Themen beschäftigen« bis zum stärkeren »Da der Leitmedienwechsel überall stattfindet, müssen entsprechende Themen auch überall integriert werden!«. Die integrative Position ist bereits in vielen aktuellen Lehrplänen zu finden. Oft wird dabei in Lehrplanzusätzen definiert, was im Bereich der Digitalisierung zu vermitteln sei, ein eigenes Fach oder dafür reservierte Unterrichtsstunden sind dafür aber nicht vorgesehen. In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung zeigt sich diese Position darin, dass keine entsprechend expliziten Ausbildungsmodule mit digitalen Themen vorgesehen sind, sondern diese in andere Module integriert werden.
Leitmedienwechsel-Reaktion 2: Es braucht ein Fach
Ohne Zeitgefäß fehle dem Thema die notwendige Verbindlichkeit, monieren die Verfechterinnen und Verfechter eines eigenen Fachs. Im Vergleich zu den als Fächer strukturierten Bereichen würden überfachliche Aspekte auf mehreren Ebenen oft marginalisiert, wenn die Ressourcen fehlen. In der Schule würden sich Lehrkräfte daher eher auf Themen konzentrieren, für die Noten vergeben werden. In der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern werde das Gewicht stärker auf die Fächer als auf überfachliche Aspekte gelegt, sowohl was die Ausbildungszeit der Studierenden als auch was die Schaffung von entsprechenden Lehrstühlen betrifft. Schulbehörden und Schulleitungen würden Weiterbildungen eher als unumgänglich akzeptieren, wenn das Thema auf dem Stundenplan stehe, und Lehrmittelhersteller sähen eher einen Markt für Themen, die in der Schule als Fach definiert sind. Angesichts der Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre betrachten Kritiker die Integrationsvariante als gescheitert. Erst ein eigenes Fach mit Zeitgefäß und Noten sorge für die notwendige Verbindlichkeit  a1182.
a1182.
Leitmedienwechsel-Reaktion 3: Es braucht sowohl ein Fach als auch Fächerintegration
Die Wahl zwischen Integration und eigenem Fach sei ein falsches Dilemma, das in den letzten 30 Jahren oft die Bildungspolitik blockiert habe, entgegnen demgegenüber die Vertreter der Leitmedienwechsel-Reaktion 3: Während bei der Integration in alle Fächer die Verbindlichkeit fehlt, droht bei der Schaffung eines eigenen Fachs das Thema an eine Speziallehrkraft ausgelagert zu werden. Die übrigen Lehrerinnen und Lehrer fühlten sich damit nicht mehr verpflichtet, sich um Aspekte der Digitalisierung zu kümmern, denn dafür sei ja nun jemand anderes zuständig. Damit ist die Empfehlung zum Leitmedienwechsel bei dieser Position kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch: Es brauche sowohl ein Fach als auch eine Fächerintegration  a1183. Es zweifle schließlich auch niemand an einem Schulfach Deutsch, obwohl in allen anderen Schulfächern ebenfalls Deutsch gesprochen wird.
a1183. Es zweifle schließlich auch niemand an einem Schulfach Deutsch, obwohl in allen anderen Schulfächern ebenfalls Deutsch gesprochen wird.
Leitmedienwechsel-Reaktion 4: Schule muss neu gedacht werden
Die bisher beschriebenen Reaktionsweisen 1 bis 3 betrachten digitale Kompetenzen als zusätzlichen Aspekt, welcher die bisherigen Rahmenbedingungen von Schule (Lehrpläne, Fächer, Stundenplan, Prüfungsformen usw.) nicht infrage stellt. Für Vertreter der Leitmedienwechsel-Reaktion 4 hingegen ist Schule in der bisherigen Form veraltet und ungeeignet für die Herausforderungen der Zukunft. Der Grundgedanke dieser Position geht davon aus, dass in der heutigen globalisierten und vernetzten Welt die großen Probleme in interdisziplinären Teams angegangen werden müssen. Die heutige Schule sei auf die Bedürfnisse der Industriegesellschaft ausgerichtet  a1043und sei deshalb selbst auch wie eine Fabrik organisiert
a1043und sei deshalb selbst auch wie eine Fabrik organisiert  a1175: Kinder und Jugendliche würden entsprechend ihrem Alter in Schulzimmer gesteckt, in denen eine einzige Person in 45-Minuten-Portionen erkläre, was richtig und was falsch sei. Dieses auswendig gelernte Wissen werde dann in Einzelprüfungen wieder abgefragt, starre und straffe Strukturen also, in denen die Gleichschaltung aller Produkte und Menschen angestrebt würde. Aus dieser Kritik wird abgeleitet, dass die Fabrikschule von gestern nicht geeignet sei, Schülerinnen und Schüler auf die Welt von morgen vorzubereiten
a1175: Kinder und Jugendliche würden entsprechend ihrem Alter in Schulzimmer gesteckt, in denen eine einzige Person in 45-Minuten-Portionen erkläre, was richtig und was falsch sei. Dieses auswendig gelernte Wissen werde dann in Einzelprüfungen wieder abgefragt, starre und straffe Strukturen also, in denen die Gleichschaltung aller Produkte und Menschen angestrebt würde. Aus dieser Kritik wird abgeleitet, dass die Fabrikschule von gestern nicht geeignet sei, Schülerinnen und Schüler auf die Welt von morgen vorzubereiten  a1184. Schule müsse also grundlegend neu gestaltet werden, um den Erfordernissen im Leitmedienwechsel gerecht zu werden.
a1184. Schule müsse also grundlegend neu gestaltet werden, um den Erfordernissen im Leitmedienwechsel gerecht zu werden.
Читать дальше
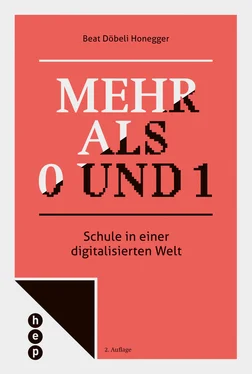
 a1192. In der Schule sollen diejenigen Kompetenzen gefördert werden können, die durch die Digitalisierung bedroht werden. Vertreterinnen und Vertreter dieser Position sehen die gesunde Entwicklung von Kindern durch digitale Medien bedroht, dies insbesondere in der Schule. Häufig sind Aussagen der folgenden Art zu hören:
a1192. In der Schule sollen diejenigen Kompetenzen gefördert werden können, die durch die Digitalisierung bedroht werden. Vertreterinnen und Vertreter dieser Position sehen die gesunde Entwicklung von Kindern durch digitale Medien bedroht, dies insbesondere in der Schule. Häufig sind Aussagen der folgenden Art zu hören: