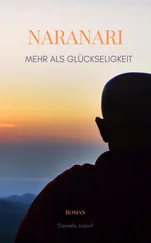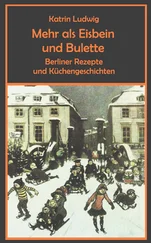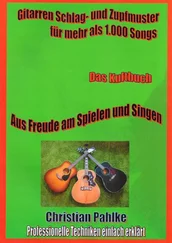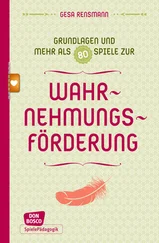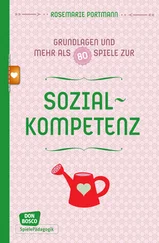› Auf der gesellschaftlichen Ebene führt der Leitmedienwechsel zu einem Kontrollverlust sowohl von Organisationen als auch von Einzelpersonen.
› Computer prägen das Denken und Handeln sowohl von Einzelnen als auch von Organisationen.
Weiterführende Literatur
› Pedro Domingos (2015): The Master Algorithm  b6040
b6040
› Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee (2014): The Second Machine Age  b5404
b5404
› Michael Seemann (2014): Das Neue Spiel – Strategien für die Welt nach dem digitalen Kontrollverlust  b5961
b5961
› Constanze Kurz und Frank Rieger (2013): Arbeitsfrei  b5378
b5378
› Mercedes Bunz (2012 ): Die stille Revolution  b5072
b5072
› Dirk Baecker (2007): Studien zur nächsten Gesellschaft  b4152
b4152
› David Weinberger (2007): Das Ende der Schublade. Die Macht der neuen digitalen Unordnung  b3258
b3258
› Michael Giesecke (2002): Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft  b2961
b2961
› Lev Manovich (2001): The Language of New Media  b3145
b3145
› Manuel Castells (1996): Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft  b4855
b4855
› Nicholas Negroponte (1995): Total Digital  b99
b99
› Klaus Haefner (1982): Die neue Bildungskrise  b127
b127
› Alvin Toffler (1970): Future Shock  b4466
b4466
Alle zitierten Quellen dieses Kapitels finden Sie unter  t16001.
t16001.
2 Wie soll die Schule auf den Leitmedienwechsel reagieren?
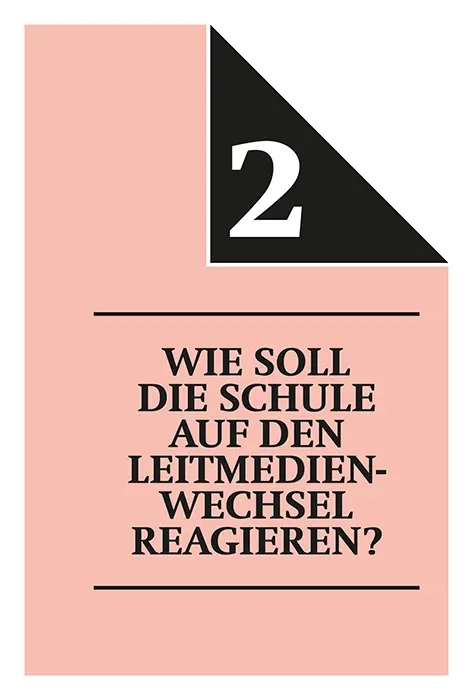
Der durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung getriebene Leitmedienwechsel vom Buch zum Computer birgt große Herausforderungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Individuen. Wie soll die Schule damit umgehen  f154? Als Antwort auf diese Frage gibt es zahlreiche Empfehlungen, die sowohl in der Bildungspolitik als auch an Elternabenden und in Leserbriefspalten kontrovers diskutiert werden. Nicht nur bezüglich der Tragweite der Entwicklung scheiden sich die Geister. Auch die Bedeutung von Allgemeinbildung, Schule und Staat stehen zur Diskussion. Da bei dieser Frage Zukunftsprognosen, persönliche Werthaltungen und eigene Schulerfahrungen zusammenkommen, ist schwerlich mit Einigkeit zu rechnen.
f154? Als Antwort auf diese Frage gibt es zahlreiche Empfehlungen, die sowohl in der Bildungspolitik als auch an Elternabenden und in Leserbriefspalten kontrovers diskutiert werden. Nicht nur bezüglich der Tragweite der Entwicklung scheiden sich die Geister. Auch die Bedeutung von Allgemeinbildung, Schule und Staat stehen zur Diskussion. Da bei dieser Frage Zukunftsprognosen, persönliche Werthaltungen und eigene Schulerfahrungen zusammenkommen, ist schwerlich mit Einigkeit zu rechnen.
Bevor der Autor selbst Stellung bezieht, wird in diesem Kapitel zunächst das gesamte Spektrum aufgezeigt, welche Reaktionsweisen auf den Leitmedienwechsel an Schulen zu beobachten sind. Diese »Leitmedienwechsel-Reaktionsskala« erleichtert einerseits den Überblick über die Debatte. Die Skala kann aber auch ganz konkret in Diskussionen hilfreich sein, um verschiedene Gesprächsbeiträge und Standpunkte einordnen und die dahinterstehenden Positionen voneinander abgrenzen beziehungsweise überhaupt erkennen zu können.
Leitmedienwechsel-Reaktion 0: Ignorieren
Die einfachste Art, auf den Leitmedienwechsel zu reagieren, besteht darin, den Wandel auszublenden oder die Folgen für Schule und Bildung zu leugnen  a1180. Diese Haltung trifft man im bildungspolitischen Alltag häufig an. Mitunter ist es jedoch schwierig abzuschätzen, ob es sich beim Ignorieren des Themas um eine bewusste oder unbewusste Entscheidung handelt. Woran lässt sich das Ignorieren eines Themas überhaupt erkennen? Äußert es sich darin, dass ein Thema nicht angesprochen wird? Es gibt Dokumente, welche diese Ignoranz sichtbar werden lassen. Die derzeit wählerstärkste Schweizer Partei, die Schweizerische Volkspartei (SVP), hat 2010 einen Lehrplanentwurf für die gesamte Schweizer Volksschule vom Kindergarten bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit vorgelegt. In dem 94-seitigen Schriftstück kommt der Begriff »Computer« gerade zwei Mal und der Begriff »Internet« ein einziges Mal vor, jedoch nie im Zusammenhang mit der Frage, was Schülerinnen und Schüler künftig lernen sollen. Stattdessen wird die lähmende Verzettelung des heutigen Unterrichts kritisiert und eine Konzentration auf die basalen »Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen« gefordert. Dementsprechend findet Digitalisierung und Leitmedienwechsel bei der SVP nicht statt. Dass die Digitalisierung kein Thema ist, dürfte eine bewusste Konsequenz der Parteipolitik sein, die sich auch außerhalb der Bildung auf Altbewährtes fokussiert.
a1180. Diese Haltung trifft man im bildungspolitischen Alltag häufig an. Mitunter ist es jedoch schwierig abzuschätzen, ob es sich beim Ignorieren des Themas um eine bewusste oder unbewusste Entscheidung handelt. Woran lässt sich das Ignorieren eines Themas überhaupt erkennen? Äußert es sich darin, dass ein Thema nicht angesprochen wird? Es gibt Dokumente, welche diese Ignoranz sichtbar werden lassen. Die derzeit wählerstärkste Schweizer Partei, die Schweizerische Volkspartei (SVP), hat 2010 einen Lehrplanentwurf für die gesamte Schweizer Volksschule vom Kindergarten bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit vorgelegt. In dem 94-seitigen Schriftstück kommt der Begriff »Computer« gerade zwei Mal und der Begriff »Internet« ein einziges Mal vor, jedoch nie im Zusammenhang mit der Frage, was Schülerinnen und Schüler künftig lernen sollen. Stattdessen wird die lähmende Verzettelung des heutigen Unterrichts kritisiert und eine Konzentration auf die basalen »Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Rechnen« gefordert. Dementsprechend findet Digitalisierung und Leitmedienwechsel bei der SVP nicht statt. Dass die Digitalisierung kein Thema ist, dürfte eine bewusste Konsequenz der Parteipolitik sein, die sich auch außerhalb der Bildung auf Altbewährtes fokussiert.
Weniger klar ist die Sache bei Bildungsexpertinnen und -experten. Einerseits existiert eine Fülle an spezifischer Literatur, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Konsequenzen die Digitalisierung für Lehrpläne, Unterrichtsgestaltung, Lehrerinnen- und Lehrerausbildung und Schulhausinfrastruktur haben sollten  f154. Andererseits scheint die allgemeine deutschsprachige bildungspolitische Literatur das Thema »Leitmedienwechsel« bisher weitgehend zu ignorieren. So zählen zwei neuere bildungspolitische Publikationen die Digitalisierung beziehungsweise den Leitmedienwechsel nicht zu den aktuellen Herausforderungen der Schule. Rolf Dubs liefert in seinem 2010 publizierten Buch Bildungspolitik und Schule – wohin
f154. Andererseits scheint die allgemeine deutschsprachige bildungspolitische Literatur das Thema »Leitmedienwechsel« bisher weitgehend zu ignorieren. So zählen zwei neuere bildungspolitische Publikationen die Digitalisierung beziehungsweise den Leitmedienwechsel nicht zu den aktuellen Herausforderungen der Schule. Rolf Dubs liefert in seinem 2010 publizierten Buch Bildungspolitik und Schule – wohin  b4790kurze und leicht verständliche Entscheidungshilfen zu 38 wichtigen Schulthemen, Digitalisierung oder Leitmedienwechsel sucht man jedoch vergebens. Auch in den 18 Beiträgen des 2011 von Lucien Criblez, Barbara Müller und Jürgen Oelkers herausgegebenen Sammelbands Die Volksschule zwischen Innovationsdruck und Reformkritik
b4790kurze und leicht verständliche Entscheidungshilfen zu 38 wichtigen Schulthemen, Digitalisierung oder Leitmedienwechsel sucht man jedoch vergebens. Auch in den 18 Beiträgen des 2011 von Lucien Criblez, Barbara Müller und Jürgen Oelkers herausgegebenen Sammelbands Die Volksschule zwischen Innovationsdruck und Reformkritik  b5210ist der Leitmedienwechsel erstaunlicherweise kein Thema. Selbst im Beitrag zum Thema »Lehrmittel« wird die Digitalisierung nicht einmal im Abschnitt Künftige Entwicklungen erwähnt
b5210ist der Leitmedienwechsel erstaunlicherweise kein Thema. Selbst im Beitrag zum Thema »Lehrmittel« wird die Digitalisierung nicht einmal im Abschnitt Künftige Entwicklungen erwähnt  t15326. Der Begriff »multimedial« fällt zwar mehrfach, aber digitalen Medien bleibt im Text knapp die Rolle der Ergänzung zum gedruckten Lehrmittel.
t15326. Der Begriff »multimedial« fällt zwar mehrfach, aber digitalen Medien bleibt im Text knapp die Rolle der Ergänzung zum gedruckten Lehrmittel.
Читать дальше
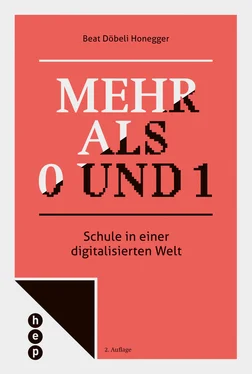
 b6040
b6040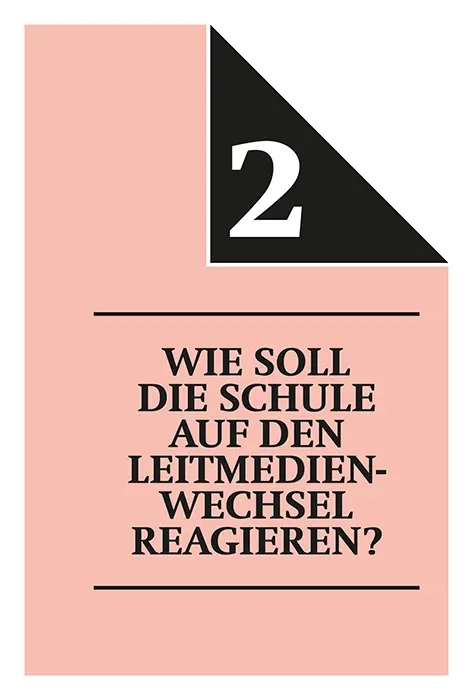
 f154? Als Antwort auf diese Frage gibt es zahlreiche Empfehlungen, die sowohl in der Bildungspolitik als auch an Elternabenden und in Leserbriefspalten kontrovers diskutiert werden. Nicht nur bezüglich der Tragweite der Entwicklung scheiden sich die Geister. Auch die Bedeutung von Allgemeinbildung, Schule und Staat stehen zur Diskussion. Da bei dieser Frage Zukunftsprognosen, persönliche Werthaltungen und eigene Schulerfahrungen zusammenkommen, ist schwerlich mit Einigkeit zu rechnen.
f154? Als Antwort auf diese Frage gibt es zahlreiche Empfehlungen, die sowohl in der Bildungspolitik als auch an Elternabenden und in Leserbriefspalten kontrovers diskutiert werden. Nicht nur bezüglich der Tragweite der Entwicklung scheiden sich die Geister. Auch die Bedeutung von Allgemeinbildung, Schule und Staat stehen zur Diskussion. Da bei dieser Frage Zukunftsprognosen, persönliche Werthaltungen und eigene Schulerfahrungen zusammenkommen, ist schwerlich mit Einigkeit zu rechnen.