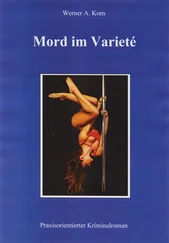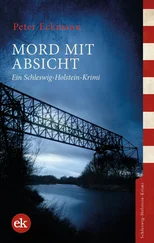„Meet your fish“ stand in schwungvollem Blau auf einem weißen Plakat über der kulinarischen Brautschau.
Freilich, die älteren unter den Touristen monierten fast immer die bescheidene Größe der jeweiligen Exemplare: „Früher waren die viel größer. Das sind ja alles bloß Setzlinge, hätte man zu unserer Zeit ins Meer zurückgeworfen.“ Vergilbte Fotos an der Wand zeigten verwegene Typen neben Tunfischen an einem Kranhaken, die doppelt oder dreimal so groß waren wie sie selbst. Weshalb die Bilddokumente unter den männlichen Gästen stets mehr Beachtung fanden als die Angebote der Gegenwart.
Den Fischern von Grado war es hoch anzurechnen, dass Zuwanderer aus Sri Lanka im Zero Miglia mit derselben Gelassenheit bedient wurden wie die mit Kameras bewehrten Zaungäste aus Villach, Graz, Linz oder Wien. Es hatte sich irgendwann einer von ihnen um die Jahrtausendwende vom Indischen Ozean nach Grado durchgeschlagen, ein paar Hundert waren gefolgt, um das Grauen des dortigen Bürgerkriegs zwischen Tamilen und Singhalesen hinter sich zu bringen. Eine ganze Schar von ihnen hatte bei der COOP Arbeit und Brot gefunden. Zumindest am Zahltag mischten sie sich im Zero Miglia unter die Gäste und kontrastierten mit ihrem melodischen Sprachfluss die Gutturallaute der Hellhäutigen aus dem Norden.
Jetzt aber, es war knapp vor zwei Uhr morgens, kamen sie angerückt wie ein Trupp Heinzelmännchen. Eine Gruppe, um zu reinigen, die andere, um zu beladen, schlüpften sie in ihre Gummistiefel. Mit Lappen, Bürsten und einer auf geruchlos gemixten Desinfektionslauge nahmen sie sich den Fuhrpark vor. Zuerst ließen sie das restliche Schmelzwasser aus den Kühlkabinen abfließen, um danach alles blitzblank zu scheuern.
Mahi, ihr Vorarbeiter, blickte auf die Uhr. Man war etwas spät dran. Schon wartete Gustavo im Büro des Fuhrparks darauf, starten zu können. Auch der blickte auf die Uhr. Ab fünf waren die Stadtzentren seiner Stationen für den LKW-Verkehr freigegeben, in den meisten Fällen allerdings nur bis elf. Da hieß es sich sputen und gut Ausschau halten nach wegelagernden Polizisten mit ihren Tempomessern. Keine Minute später als fünf wollte er in Palmanova vorfahren. Dann würde es weitergehen, Richtung Pordenone, Vittorio Veneto, Belluno und Cortina. Um drei Uhr nachmittags wollte er wieder zu Hause sein, sich eine knappe Stunde hinlegen und dann zu den Freunden gehen, ins gut versteckte Stammlokal in einem Hof inmitten der Gradenser Altstadt. Sie hatten nämlich eine alte Segeljacht ersteigert, die von ihrem Besitzer liegen gelassen worden war. Vielleicht war er gestorben, vielleicht hatte er einen Unfall gehabt, vielleicht war er pleite. Jedenfalls waren beträchtliche Liegegebühren angefallen und die Marina hatte per Exekution die Erlaubnis zur Versteigerung erwirkt, um so die Liegekosten hereinzubringen. Und die wollten Mario und seine Kumpel auf Vordermann bringen.
Langsam wurde es hell. Für Gustavo begann die Schicht, für die Putz- und Ladebrigade endete sie. Mahi inspizierte Wagen elf, Gustavos Wagen, für die Freigabe. Alles okay. Also kappte er den Netzanschluss der Stromversorgung, worauf sich automatisch der Generator des LKW einschaltete. Das hieß freie Fahrt für Gustavo.
Es war eine ganz normale Tour gewesen. Wie geplant genehmigte sich Gustavo nach der Rückkehr aus Cortina ein kleines Schläfchen. Danach ging es ab ins Stammlokal. Man besprach die anstehenden Reparaturarbeiten an der Jacht, überlegte, wer mit der Sanierung des Hauptsegels und der Genua beauftragt werden sollte, als es plötzlich laut wurde. Vier Carabinieri bahnten sich einen Weg zwischen Oleandertöpfen und überladenen Windelständern durch den Hof.
Ihr Kommandeur musterte die Runde der drei Männer und bellte:
„Gustavo Priolo, aufstehen!“
Die zwei Freunde sahen Gustavo fragend an. Dieser erhob sich langsam.
„Sind Sie Gustavo Priolo?“
„Warum?“, fragte dieser ziemlich überfordert.
Für die Carabinieri ein eindeutiges Ja: „Mitkommen, Sie sind verhaftet.“
Gustavo sah in Richtung Tür, in der die Wirtin mit einer riesengroßen Schüssel erschien, aus der Cozze in einer Olivenöl-Knoblauch-Weißweinsoße dampften. Für den Kommandeur war dieser Blick bereits ein eindeutiger Fluchtversuch. „Handschellen“, kommandierte er, worauf die Wirtin erschrocken die Schüssel mit den Cozze fallen ließ und sich ein köstlicher Duft aus Brandung und Knoblauchblüten zwischen den engen Gemäuern ausbreitete. Der Krach der berstenden Schüssel schreckte die Hauskatze auf, die sich sodann in einem Bogen um die Stiefel der Uniformierten herum dem Quell des Duftes näherte. Bis sie die schrille Stimme zusammenzucken ließ, die aus der Mundöffnung des Frauenkopfs im ersten Stock plärrte: „Eh, Gustavo, quello che hai fatto?“
Gustavo blickte nach oben und brüllte zurück: „Nichts habe ich gemacht, gar nichts. Ich weiß nicht, was die von mir wollen!“
Commissario Bruno Vossi hatte ein Bündel von Seiten vor sich, die er sich zu diversen Stichworten der Geschichte des Mittelalters ausgedruckt hatte. Das Lesen vom Bildschirm schätzte er ganz und gar nicht. Kein Vergleich mit Blättern aus echtem Papier, das sich leichter herumtragen ließ als sein Laptop. „Ja, auch auf die Toilette“, hatte er seiner Frau Jelena verärgert beigepflichtet.
Wenn man ihn so ansah, gab man seinen Kollegen ohne Abstriche recht. Ganz entschieden erinnerte Commissario Vossi an den Mann auf dem Werbeplakat für das Bier von Moretti. Nicht nur wenn er, wie eben jetzt, ein volles Glas Bier in Richtung seines Schnauzers führte, sondern weil er, wie die Moretti-Figur, keinem der hier vertretenen Typen spezifisch zuzuordnen war. Sein Mustache passte zum Kommunisten Peppone aus den Schwarz-Weiß-Filmen der Nachkriegszeit, sein Hut zu einem slowenischen Bauern, seine milden Gesichtszüge zu einem Wiener Konditormeister und in den Tag hinein blickte er mit den eisblauen Augen eines Tiroler Schutzhüttenwirtes. Kurzum, er war übernational. Bei ihm war es eine Laune der Natur, bei der Bierfigur für Moretti Absicht. Die Brauerei war stolz auf ihre Tradition und alle Völker der k. u. k. Monarchie sollten ihr Bier trinken. Ihre Galionsfigur mit dem Krügel in der Hand war gewissenhaft entworfen worden. Für die Schöpfer des Plakats galten die gleichen strengen Regeln wie für das Erscheinungsbild Kaiser Franz Josephs. Kaiser Wilhelm durfte Preuße sein, Napoleon III. Franzose, König Viktor Emanuel Italiener – oder beinahe. Mit Franz Joseph aber mussten sich Tschechen, Deutsche, Ungarn, Polen, Italiener, Kroaten, Juden und islamische Bosnier gar identifizieren können. Dass der Alte Kaiser von Natur aus mit seinem Backenbart und buschigen Augenbrauen etwas von einem Weihnachtsmann in Militäruniform hatte, kam den Intentionen der Hofstilisten Wiens sehr entgegen. Weihnachtsmänner waren supranational.
Commissario Vossi setzte sein Bierglas ab und las weiter. Der Moment war nahe, da Jelena, seine Angetraute, nachgeben und sich mit einer Kulturreise durch Deutschland einverstanden erklären würde. Sollte er recht behalten, verdankte er dies seinem keineswegs nur gespielten Interesse an Adelheid von Burgund. Die war um das Jahr 1000 aus italienischen Kerkern zur römisch-deutschen Kaiserin aufgestiegen. Nicht bloß als Gemahlin eines gekrönten Hauptes, sondern als dessen Mentorin, im Vokabular von heute würde man sagen, als seine Stabschefin.
Um Jelenas sehr kümmerlicher Begeisterung für die Geschichte des Mittelalters etwas mehr Leben einzuhauchen, las er ihr vor: „Sie war eine gebildete Frau, sprach vier Sprachen und war sehr belesen. Sie übte sowohl in Italien als auch im Reich nördlich der Alpen großen Einfluss auf die Politik aus.“
Vossi registrierte das Desinteresse seines Publikums, ließ sich aber nicht entmutigen: „Bedenke, hunderte Jahre vor Elisabeth I. von England, Kaiserin Maria Theresia, Katharina der Großen, Golda Meir, Margaret Thatcher und Angela Merkel.“
Читать дальше