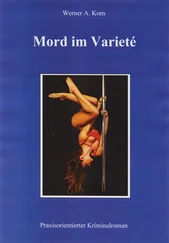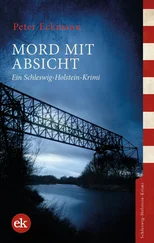Tatsächlich glitt ein Superlativ maritimer Eleganz wie von unsichtbarer Hand gezogen in Richtung Pier. Das Bild, so schön es auch war, erinnerte gewaltig an den Kitsch von Heimatfilmen der Marke Weißes Rössl und Wolfgangsee, Fischer und Capri. Eine der Damen fühlte sich an Lohengrins Schwan erinnert und blieb dafür unbestraft. Die versammelten Herren beschäftigte ohnedies mehr die Frage, was so ein „Kahn“ wohl pro hundert Kilometer an Treibstoff nuckeln würde.
„Seemeilen, Herr Landeshauptmann. Seemeilen, wenn ich anmerken darf.“
Worauf ein umständliches Konvertieren von Kilometern in Seemeilen einsetzte. Champagner, Hummer, Austern und Kaviar im Gegenwert von rund 10.000 Euro verloren derweil in der direkten Sonneneinstrahlung rapide an Wert.
„Was kostet sowas?“, fragte einer der Trachtenträger, der sich in greifbarer Nähe zum Büffet aufgehalten hatte, seinen Nebenmann, einen Doktor Schaden, Leiter der Risikoabteilung der Montana-Maritim.
„Was jetzt?“
„Na das Schiff.“
„Knapp über 15 Millionen.“
„15 Millionen! Und das kann sich jemand leisten, der vor knapp zwei Jahrzehnten noch als Vulkanizer an der montenegrinischen Küste Reifen flickte?“
„Nicht so laut, die Herren vom Balkan werden nicht gerne an das erinnert, was sie gestern noch waren.“
„Aber wie verdient ein Vulkanizer von heute auf morgen das Geld für solch einen Luxus?“
„Na ja, der Ministerpräsident und die halbe Regierung Montenegros fressen ihm angeblich aus der Hand. Abgesehen davon, er hat die Jacht ja nicht gekauft. Bloß geleast.“
„Und was macht da so eine Leasingrate aus?“
„Etwa 350.000 Euro im Monat.“
„Das müsste sich dann schon rechnen für Ihre Bank.“
„Davon dürfen Sie ausgehen.“
„Aber das Risiko. Was ist, wenn mit dem Schiff etwas passiert?“
„Alles versichert bei der Albion. Und bedenken Sie: Wo sonst bekommen Sie heute noch 16 bis 20 Prozent fürs Verborgen?“
„Und wer von den Herren ist der Glückliche, der sich eine Leasingrate von 350.000 im Monat leisten kann?“
„Keiner von ihnen. Ich gehe davon aus, dass er an Bord ist.“
„Sie kennen ihn nicht persönlich?“
„Kaum jemand von uns kennt ihn persönlich. Er ist einer von den Scheuen und macht sich gern rar.“
In diesem Augenblick übertönte das Rotorengeräusch eines Hubschraubers jede weitere Unterhaltung. Das Luftvehikel umkreiste die Jacht, landete auf Deck und entschwand kurz darauf hinter den Hausdächern.
„Und was war das?“, wollte der Trachtenträger wissen.
„Keine Ahnung …“
Die Antwort ging im zigfachen Tuten der Schiffsirenen aus der Marina unter. Dazu nahmen zwei Löschkähne der Hafenverwaltung Triest die gleitende Diva in die Mitte und ließen Fontänen hochgehen, die im Gegenlicht der Sonnenstrahlen das Farbenspiel zweier Regenbögen herbeizauberten.
Wenig später galt das Interesse einer braungebrannten Blondine mit ostentativem Dekolletee, langen Beinen und botox-geschwulsteten Lippen, die in ein Mikrofon hineinkicherte und zu ein paar Sätzen in unbeholfenem Englisch eine Leine losließ, an deren Ende eine Champagnerflasche hing. Die Flasche beschrieb einen eleganten Bogen und erfüllte alle Erwartungen, indem sie am Rumpf der Dunja zerschellte. Damit war das Schiff nach allen Regeln der christlichen Seefahrt getauft und die Ehrengäste wurden an Bord gebeten.
Zwischen edelstem Holz und spitzfindigem Design erklärte eine Art Dressman ein wenig über die Geschichte Ferrettis, des Erbauers der Jacht. Das Unternehmen sei 1968 von Norberto Ferretti, dem Powerboat-Weltmeister von 1994, gegründet worden. Im Frühjahr 2009 hätte das Unternehmen mehrfach umgeschuldet werden müssen, bevor im Jonglieren mit den Millionen in Rot die Chinesen zuschlugen. Eine Wendung, an die auch der Herr Landeshauptmann als letzten Ausweg dachte, sollte die Montana-Bank aus der Spur laufen und nicht mehr als sein Esel-streck-dich herhalten können. Nach seinem persönlichen Leitspruch: Alles hat ein gutes Ende, und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende.
Der Dressman hatte ausgeredet und wandte sich an den Ministerpräsidenten aus Montenegro: „Ich darf Sie nun bitten, in Vertretung des verhinderten Bootseigners nach gutem Seemannsbrauch dieses reine Stück Gold in die Luke hier unter dem Führerstand zu legen, wo es für immer bleiben soll.“ Damit wies er auf eine ringartige Ausnehmung im Teakholzdeck und reichte dem Ministerpräsidenten einen Krugerrand. Mit leicht zittriger Hand legte dieser die Münze an die zugewiesene Stelle. Worauf ein Matrose im Blaumann mit der Aufschrift „Dunja“ wortlos vortrat und mit schwerem Gerät den Deckel des Ringes vierfach vernietete. Ein anderer Matrose brachte den Hals der zerbrochenen Champagnerflasche. Der Kapitän, der sich bis dato im Hintergrund gehalten hatte, hob ihn wie eine Trophäe hoch und zeigte ihn herum. Die Bordgäste musterten das Stück zerbrochenes Glas mit dem sinnlos gewordenen Korken verständnislos.
Stunden später, auf der Rückfahrt in Richtung Villach, erklärte Doktor Schaden seinem Gesprächspartner vom Büffet die Bedeutung der Vorgänge bei einer Schiffstaufe.
„Ein Glück, dass die Flasche zerbrach und der Korken im Hals stecken blieb.“
Er erntete dafür einen fragenden Blick seines Fahrgastes.
„So eine Schiffstaufe ist ein Ritual, so heilig und ernst wie eine Krönung. Taufpate eines Schiffes ist stets eine Frau. Ein Mann als Taufpate wäre ein böses Omen. Nach dem Zerschellen der Flasche an der Bordwand wird der Korken untersucht, der zum Beweis der Wirksamkeit der Taufe noch fest im oberen Rest des Flaschenhalses sitzen muss.“
„Und was hat es mit dem Goldstück auf sich?“, wollte der Trachtenträger wissen.
„Wenn auf dem Segelschiff der Großmast eingesetzt wird, legt man in die Höhlung der Mastspur ein blankes Goldstück, dort, wo danach der Fuß des Mastes ruht. Der Messingring unter dem Führerstand beim Motorschiff ersetzt die Mastspur. Das Goldstück, genannt Goldfuchs, soll vor den unbekannten Mächten des Meeres schützen.“
„Und die Seeleute nehmen das heute immer noch ernst?“
„Heute genauso wie vor Hunderten von Jahren. Zwischenfälle während der Schiffstaufe werden als böses Omen gedeutet. Sollte die Sektflasche nicht zerbrechen oder das Schiff beim Stapellauf auf der Helling hängen bleiben, heuern manche Seeleute erst gar nicht an. Auch heute erzählt man sich dann allerlei Geschichten. So wie die von der Melanie Schulte. Die kennen Sie doch, oder?“
„Nicht die Spur.“
„Sie blieb beim Stapellauf auf der Helling hängen, die schiefe Ebene, über die ein neues Schiff seinem nassen Element übergeben wird. Wenige Wochen nach der Schiffstaufe im November 1952 blieb sie im Nordatlantik spurlos verschwunden.“
„Und wie war das bei der Titanic? Ging da bei der Schiffstaufe auch etwas schief?“
„Allerdings!“ Doktor Schaden war nun endgültig in seinem Element.
„Sie fand aus Termingründen erst gar nicht statt. Das ist schon einmal äußerst ungewöhnlich. Und vor der Abfahrt am 2. April 1912 kletterte ein Heizer durch den vierten Rauchfang, der ja nur Attrappe war und zur Belüftung diente, und blickte von oben herab auf die Mole. Als die Seeleute an Land sein rußgeschwärztes Gesicht sahen, war für sie klar: Die Titanic war dem Untergang geweiht. Zwölf Tage später versank sie nach der berühmten Kollision mit dem Eisberg und nahm über 1500 Mann mit in ihr nasses Grab.“
„Aber bei unserer Schiffstaufe war alles in Ordnung. Also kein Grund zur Sorge, oder?“
„Da war schon ein gewichtiger Schönheitsfehler.“
„Und der wäre?“
„Der Eigner war nicht anwesend. Sie haben ja selbst gesehen, wie der Hubschrauber auf Deck landete und Minuten vor der Zeremonie mit ihm abschwirrte.“
Читать дальше