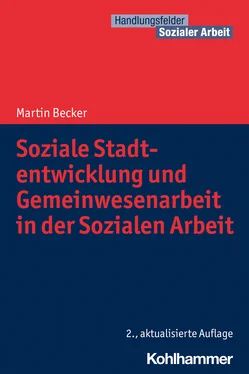• Der Wille bzw. die Interessen der leistungsberechtigten Menschen als Ausgangspunkt jeglicher Arbeit und nicht Wünsche oder Bedarfe
• Vorrang aktivierender Arbeit vor betreuender Tätigkeit
• Personale und sozialräumliche Ressourcen spielen bei der Gestaltung von Arrangements eine entscheidende Rolle
• Aktivitäten sind immer zielgruppen- und bereichsübergreifend angelegt
• Vernetzung und Integration verschiedener sozialen Dienste sind Grundlage einer nachhaltig wirksamen Sozialen Arbeit (Hinte in: Hinte/Lüttringhaus/Oelschlägel 2007: 9).
In den 1990er Jahren erlebte die von Saul Alinsky bereits Mitte des 20. Jhs. in den USA entwickelte und praktizierte Mobilisierung von Bevölkerung für ihre eigenen Anliegen unter dem Namen »Community Organizing« (CO) eine Renaissance in Europa, insbesondere in Deutschland. Morlock u. a. veröffentlichten 1991 einen Vergleich zwischen GWA und CO. Nach der Jahrtausendwende hatte sich CO in Deutschland weiterverbreitet, wofür auch die Gründung der Plattform »Forum Community Organizing« (FOCO 1997) als Beleg gelten darf (vgl. Szynka 2006; Penta 2007). Mehr über diese und andere Formen von sozialraumorientierter Arbeit findet sich an anderer Stelle dieses Buches sowie in der angegebenen einschlägigen Literatur (vgl. Stövesand u. a. 2013).
Zwischenzeitlich wird Gemeinwesenarbeit nicht nur in Stadtteilen und Quartieren eingesetzt, die zu »Problemgebieten« geworden sind, sondern bereits in neu aufzubauenden Stadtteilen zur Förderung des sozialen Lebens und zur Vermeidung von Problemkonstellationen implementiert (Maier/Sommerfeld, 2005) 4 . Gegen Ende der 1990er Jahre hat sich in der Fachwelt der Begriff »Stadtteil- oder Quartiermanagement« entwickelt und im Laufe der 2000er Jahre verbreitet. Dabei geht es um die Beantwortung der Fragen, wer und wie für die Entwicklung von Stadtteilen bzw. Quartieren verantwortlich sein soll und kann (Alisch 1998). Grimm, Hinte und Litges (2004) legten mit ihrer Publikation »Quartiermanagement. Eine kommunale Strategie für benachteiligte Wohngebiete« einen Vorschlag zur Systematisierung der sehr inkonsistent verwendeten Begrifflichkeiten von »Stadtteil-/Quartiermanagement«, »Gemeinwesen-/Stadtteilarbeit« vor. Hintergrund für die Management-Orientierung waren u. a. Stadtentwicklungsprogramme wie das Bund-Länder-Programm »Soziale Stadt« (2019) und der Trend zu neueren Steuerungsmodellen der öffentlichen Verwaltung (Becker 2020a). In deren Rahmen spielen sowohl die verwaltungsinterne Koordination der Kommunalpolitik als auch die »Akzentverschiebung kommunaler Leitbilder« (Hinte/Lüttringhaus/Oelschlägel 2007: 179) von der Kunden- zur Bürgerorientierung eine Rolle (Becker 2016b).
Die Implementation von Quartiermanagement unter Einsatz von Fachkräften Sozialer Arbeit ist zwischenzeitlich auch im Rahmen von Projekten der Wohnungswirtschaft feststellbar. Neben den klassischen Aufgaben des Beschwerdemanagements und der Wohnberatung stehen dabei auch allgemeine Sozialberatung, Konfliktmoderation sowie Anregungen zu und Organisation von gemeinsamen Aktivitäten der BewohnerInnen bis hin zur Initiierung von sozialen Netzwerken gegenseitiger Hilfe bei der Betreuung von Kindern, alten Menschen oder Menschen mit Behinderungen auf der Liste der Tätigkeitsbeschreibung von GemeinwesenarbeiterInnen im Dienste von kommunalen Wohnungsgesellschaften oder Wohnungsgenossenschaften. 5
Im Folgenden werden wesentliche Grundlagen Sozialer Arbeit im Handlungsfeld sozialer Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit dargestellt.
1.2 Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesen- arbeit als Handlungsfeld Sozialer Arbeit
In der Darstellung der Historie sowie der Entwicklungslinien gebietsbezogener Sozialer Arbeit wurden bereits eine Vielzahl einschlägiger Begriffe und deren Varianten erwähnt, ohne jedoch auf deren Unklarheiten, Brisanz oder Strittigkeit näherer einzugehen. Dies soll in diesem zweiten Abschnitt nachgeholt werden, weil für das Verständnis eines Handlungsfelds professioneller Sozialer Arbeit, die Grundlage eines fachlichen »State of the Art« als notwendige Bedingung erachtet wird. In der Einleitung und dem ersten Abschnitt wurde der Gegenstandsbereich, das hier zu betrachtende Handlungsfeld Sozialer Arbeit, zunächst mit »gebietsbezogener Sozialer Arbeit« umschrieben und unter Berücksichtigung historischer Wurzeln und unter Verwendung des Begriffs Gemeinwesen als »Soziale Arbeit in und mit Gemeinwesen« bezeichnet. Diese Begriffe sind zunächst als vorläufige Arbeitsbegriffe zu verstehen, die durch die folgenden Ausführungen problematisiert, diskutiert und für die Verwendung in diesem Band definiert werden.
Der Begriff »Gemeinwesen« wird im deutschen Sprachgebrauch sowohl für Gebietskörperschaften des Staatswesens (Nation, Kommune, Gemeinde) als auch für Personalverbände 6 benutzt (Duden 1995). Begrifflich ist mit »Gemeinwesen« nach demokratiepolitischem Verständnis das ›Wesen des (All-)Gemeinen‹, also aller körperschaftlich miteinander verbundenen Menschen gemeint, womit der öffentliche, politische Rahmen angesprochen ist. Ein »Gemeinwesen« kann also so unterschiedliche territorial begrenzte und politisch verfasste Einheiten umfassen wie ein gesamtes Staatswesen, ein Bundesland, eine Kommune oder ein Teil einer Kommune. Das fachliche Verständnis von Gemeinwesen aus der Perspektive der Sozialen Arbeit wird im Handbuch Gemeinwesenarbeit (GWA) folgendermaßen expliziert:
»Mit Gemeinwesen bezeichnen wir einen sozialen Zusammenhang von Menschen, der über einen territorialen Bezug (Stadtteil, Nachbarschaft), Interessen und funktionale Zusammenhänge (Organisationen, Wohnen, Arbeit, Freizeit) oder kategoriale Zugehörigkeit (Geschlecht, Ethnie, Alter) vermittelt ist, bzw. darüber definiert wird.« (Stövesand u. a. 2013: 16)
In dieser Definition finden sich, mit dem territorialen Bezug, der Betonung funktionaler Zusammenhänge sowie kategorialer Zugehörigkeiten von Menschen Merkmale, die in der Sozialen Arbeit auch für Gemeinwesenarbeit reklamiert werden. Anders als rein territoriale oder geografische Gebietsbeschreibungen wie Stadtbezirk, Stadtteil, Stadtviertel impliziert der Begriff Gemeinwesen einen sozialen und politischen Zusammenhang von Menschen, die in einem (gewissen) Territorium leben. Ebenso wenig wie Individuen und Gesellschaft (Elias 1991) unabhängig voneinander existieren, können Raum und Soziales zwar getrennt betrachtet aber nicht getrennt voneinander verstanden werden, worauf im Folgenden noch näher einzugehen sein wird. Auch im Handbuch GWA wird mit der Feststellung »Gemeinwesen ist gleichzeitig Handlungsraum [administrativ begrenztes Gebiet von Dorf bis Staat; Einfügung des Autors MB] und Sozialgefüge« (Stövesand u. a. 2013: 24) einerseits die Bedeutung des Gebietsbezuges bestätigt und gleichzeitig mit der Aussage »Raum ist demnach immer schon Sozialraum« (ebd.: 25) auf die Verbindung zwischen materieller und sozialer Bedeutung von Raum hingewiesen.
Gemeinwesen als Territorium: Stadt/Stadtteil/Stadtvierte
Die Begrifflichkeiten für die territoriale Eingrenzung von Gemeinwesen sind sowohl in der Praxis als auch in der Fachliteratur sehr heterogen. Die Problematik der Begriffsverwendung besteht u. a. darin, dass die Eingrenzung von Stadtteilen und Stadtvierteln meist auf amtlichen statistischen Bezirken (z. B. Wahlbezirke, Schulbezirke, Planbezirke, Programmgebiete etc.) beruhen, die nicht immer deckungsgleich sind und nicht mit der Einschätzung und Definition des unmittelbaren sozialen und räumlichen Lebensumfelds der Bevölkerung übereinstimmen müssen. Verwaltungsbezirke in Großstädten sind, nach ihrer Bevölkerungszahl, oft größer als eine deutsche Mittelstadt (20–100 Tsd. EinwohnerInnen), und Stadtteile in Großstädten können, gemessen an der Bevölkerungszahl, der Größenordnung einer Kleinstadt (5–20 Tsd. EinwohnerInnen) entsprechen (Statistisches Jahrbuch 1999: 63).
Читать дальше