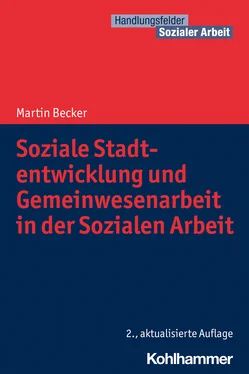Zunächst führte die unter dem Begriff »Ölkrise« bekannte Wirtschaftskrise Mitte der 1970er Jahre zur Beendigung der Reformzeit im Bildungs- und Sozialwesen. »Radikalenerlass« und Berufsverbote, als Reaktion auf die Gewaltakte der »Rote Armee Fraktion« (RAF), bremsten darüber hinaus die Aktivitäten konfliktorientierter GemeinwesenarbeiterInnen und führten zu einer Ernüchterung bezüglich der Bedeutung von Gemeinwesenarbeit in Deutschland. Als Zeichen dieser Ernüchterung wurde im Herbst 1975 im Rahmen einer Tagung über konfliktorientierte GWA in Berlin eine symbolische Todesanzeige auf die Gemeinwesenarbeit mit folgendem Wortlaut veröffentlicht:
»Nach einem kurzen, aber arbeitsreichen Leben verstarb unser liebstes und eigenwilligstes Kind GWA an Allzuständigkeitswahn, Eigenbrötelei und Profilneurose, methodischer Schwäche und theoretischer Schwindsucht, finanzieller Auszehrung und politischer Disziplinierung. Wir, die trauernden Hinterbliebenen, fragen uns verzweifelt, ob dieser frühe Tod nicht hätte verhindert werden können?« (Müller 2009: 229)
Dass Mitte der 1970er Jahre, trotz erfolgreicher Arbeit, sowohl die Victor-Gollancz-Stiftung aufgelöst als auch das Burckhardthaus Gelnhausen organisatorisch umstrukturiert wurde, scheint kein Zufall, sondern Folge der Zerreißproben zwischen meist ehrenamtlichen Vorständen, mehr oder weniger traditioneller Wohlfahrtsorganisationen und deren professionellen, vorwiegend progressiven MitarbeiterInnen gewesen zu sein. Mit der Phase des politischen Aufbruchs, durch »Studentenbewegung« und »außerparlamentarische Opposition«, zu mehr Demokratie und Beteiligung der BürgerInnen an der sie betreffenden Politik, wuchsen in der Folgezeit neue soziale Bewegungen (Frauen-, Friedens-, Öko-, Bürgerinitiativen etc.) heran, die das Bewusstsein für die Gestaltung der Lebensbedingungen und einen lokalen Bezug unter dem Slogan »global denken – lokal handeln« schärften.
Erfahrungen und Kenntnisse aus der Gemeinwesenarbeit wurden vor allem von Oelschlägel Anfang der 1980er Jahre zu einem Handlungsfeld übergreifenden Konzept »Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip« der Sozialen Arbeit formuliert (vgl. Boulet/Krauss/Oelschlägel 1980). Dabei konnte sich Oelschlägel auf ältere Quellen von Steinmeyer (1969) beziehen, der schon Ende der 1960er Jahre ein, über den Methodenbegriff hinausgehendes, Verständnis von GWA vorschlug (Oelschlägel 2013). Auch auf den Tagungen der Victor-Gollancz-Stiftung wurde GWA bereits in den 1970er Jahren als Form einer stadtteilbezogenen, kooperativen und methodenintegrativen Sozialarbeit beschrieben (Graf 1976). »Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip« war demnach zu verstehen als eine Grundorientierung, Sichtweise und Haltung professionellen sozialen Handelns, die eine grundsätzliche Herangehensweise an soziale Probleme im Rahmen professioneller Sozialer Arbeit impliziert. Mit dem »Arbeitsprinzip Gemeinwesenarbeit« verbundene Merkmale:
• »Das Arbeitsprinzip GWA erkennt, erklärt und bearbeitet, soweit das möglich ist, die sozialen Probleme in ihrer historischen und gesellschaftlichen Dimension. Zu diesem Zweck werden Theorien integriert, die aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen stammen. Damit ist das Arbeitsprinzip GWA auch Werkzeug für die theoretische Klärung praktischer Zusammenhänge.
• Das Arbeitsprinzip GWA gibt aufgrund dieser Erkenntnisse die Aufsplitterung in methodische Bereiche auf und integriert Methoden der Sozialarbeit (Casework, Gruppenarbeit usw.), der Sozialforschung (z. B. Handlungsforschung) und des politischen Handelns (Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlungen etc.) in Strategien professionellen Handelns in sozialen Feldern.
• Mit ihren Analysen, Theorien und Strategien bezieht sich GWA auf ein »Gemeinwesen«, d. h. den Ort, wo die Menschen samt ihrer Probleme aufzufinden sind. Es geht um die Lebensverhältnisse und Lebenszusammenhänge der Menschen, wie diese sie selbst sehen (Lebensweltorientierung). GWA hat eine hohe Problemlösungskompetenz aufgrund ihrer lebensweltlichen Nähe zum Quartier. Als sozialräumliche Strategie, die sich auf die Lebenswelt der Menschen einlässt, kann sie genau die Probleme aufgreifen, die für die Menschen wichtig sind, und sie dort lösen helfen, wo sie von den Menschen bewältigt werden müssen. Dabei kümmert sich GWA prinzipiell um alle Probleme des Stadtteils und konzentriert sich nicht, wie oft Bürgerinitiativen, auf einen Punkt. Damit schafft sie Kontinuität, auch wenn es in dem einen oder anderen Fall Misserfolge gibt.
• Das Arbeitsprinzip GWA sieht seinen zentralen Aspekt in der Aktivierung der Menschen in ihrer Lebenswelt. Es will sie zu Subjekten auch politisch aktiven Lernens und Handelns machen, will selbst zu einer »Handlungsstrategie für den sozialen Konflikt« werden. Das bedeutet allerdings, dass GWA die scheinbare Neutralität vieler GWA-Konzepte aufgibt und parteilich wird.« (Oelschlägel 2013: 191)
Gesellschaftliche Entwicklungen im vierten Quartal des 20. Jhs., wie ökologische Krisen, Massenarbeitslosigkeit, neue Armut, Jugendproteste, Veränderungen der Parteienlandschaft, Entstehung alternativer oder hedonistischer Milieus, stärkere Individualisierung u. ä. (Beck 1986), haben in den Sozialwissenschaften zu einer Ausdifferenzierung und Suche nach neuen Gesellschaftsbeschreibungen geführt (Pongs 1999). Mit der Orientierung an Alltag und Lebenswelt bzw. der subjektiven Lebensqualität aus Sicht der Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation ist Lebensweltorientierung (Thiersch 2009) in den 1980er Jahren zu einem zentralen Handlungskonzept der Sozialen Arbeit, so auch der GWA geworden.
In Gesellschaften und Quartieren mit großer Wertepluralität/-vielfalt machen unterschiedliche Werte möglicherweise unsicher und ängstlich. Deshalb wird Kontakt und Konfrontation tendenziell eher vermieden, wodurch Unverständnis, Missverständnis und Misstrauen eher noch anwachsen (Sennett 1983; Hinte/Lüttringhaus/Oelschlägel 2007: 99 ff.). Wenn Wertehomogenität und Wertekonsens angesichts unterschiedlicher, pluraler Lebensentwürfe und Lebensstile nicht (mehr) herstellbar sind, gehört gerade die Aushandlung von Regeln, etwa im Sinne der von Norbert Elias (1976) beschriebenen Zivilisierungsprozesse des Ausbalancierens von Machtpotentialen, mittels Diskussionen über Strittiges, Alltägliches, Einigendes, zum gesellschaftlichen Auftrag Sozialer Arbeit in Gemeinwesen, in denen Bevölkerung unterschiedlicher Herkunft, sozialer Lage und Lebensstile auf vergleichsweise engem Raum zusammenleben (müssen).
Während Oelschlägel und andere begrifflich an »Gemeinwesenarbeit« festhielten, verwendeten Hinte u. a. den Begriff »Stadtteilarbeit« und »stadtteilbezogene Soziale Arbeit« (Hinte/Metzger-Pregizer/Springer 1982) und entwickelten ein »Fachkonzept«, das zur Anwendung in einigen Handlungsfeldern Sozialer Arbeit, wie z. B. der »Jugendhilfe« (Hinte/Treeß 2007) der »Offenen Jugendarbeit« (Deinet 2005) oder der »Hilfe zur Erziehung« (Peters/Koch 2004) weiter schriftlich ausgearbeitet wurde.
Im Laufe der 1990er Jahre erfuhr der Terminus »Stadtteilorientierung« eine Umformulierung in »Sozialraumorientierung« verbunden mit zunehmender Verbreitung und Potential zu einem integrativen Handlungskonzept, mit Wirkungen über die Soziale Arbeit hinaus auch in andere Disziplinen (s. u., Literatur zu Sozialraumorientierung). Die Tatsache, …
»… dass zunehmend räumliche Einflüsse in das Blickfeld der kommunalpolitischen Akteure gerieten, dass sozialräumliche Strategien zunehmend anerkannt wurden und dass integriertes, ressortübergreifendes Denken in den Verwaltungen an Bedeutung gewinnen konnte …« (Hinte/Lüttringhaus/Oelschlägel 2007: 99)
…, kann als Ursache für die Entwicklung verschiedener politischer Fach-Programme, wie »soziale Stadtentwicklung«, »lokale und solidarische Ökonomie«, »Gesundheitsförderung«, »Bürgerschaftliches Engagement«, »Gemeindenahe Psychiatrie« etc., angesehen werden, die auf dem »Handlungskonzept Sozialraumorientierung« aufbauen. Die Prinzipien stadtteilbezogener bzw. sozialraumbezogener Arbeit nach Hinte u. a. (2007: 9) sind:
Читать дальше