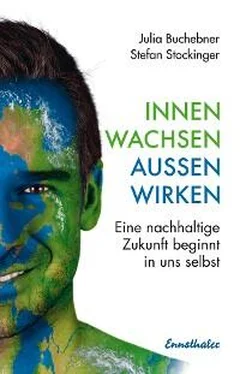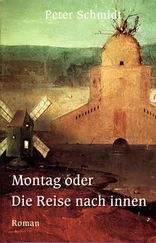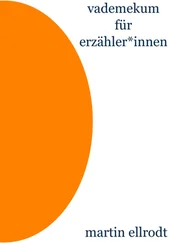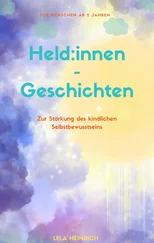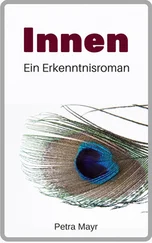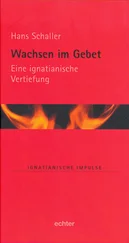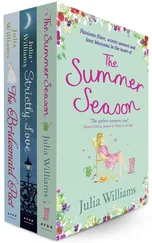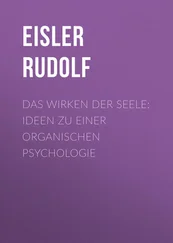1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 Was somit viel stärker ins Gewicht fallen dürfte als die Unwissenheit, ist die mangelnde oder getrübte Urteilsfähigkeit, mit welcher der innere Schweinehund über den Belang eingehender Informationen entscheidet.
Jene, die die Umweltproblematik bereits erkannt und auch akzeptiert haben, urteilen gern mit dem Glauben, sie allein könnten ohnehin nichts ändern. Manch andere hingegen beruhigen sich selbst über die Leugnung des Offensichtlichen: »Wer weiß, ob das alles stimmt, was man uns erzählt? Wem kann man heutzutage noch glauben? Wer sagt, dass der Klimawandel tatsächlich menschengemacht ist? Den gab es doch schon immer, oder!?«
Der innere Schweinehund liebt es, Informationen anzuzweifeln und generell eine skeptische Grundhaltung gegenüber Veränderungen einzunehmen. Denn solch eine Skepsis schützt gleich einmal effektiv vor notwendigen, weiterführenden Überlegungen.
Die Macht der Gewohnheit
Hat es die Information trotz aller Gegenwehr doch irgendwie in unser System geschafft, so liegen die nächsten Barrieren in unseren Gewohnheiten und Routinen. Diese laufen längst wie Automatismen ab und flüstern uns ganz heimlich und leise ins Ohr: »Wir haben es immer schon so gemacht, also machen wir es auch künftig so. Warum sollten wir daran etwas ändern? Das ist doch viel zu anstrengend und bringt ja ohnehin nicht viel.«
Im Vergleich zu einem Umdenken haben die Routinen und Gewohnheiten des inneren Schweinehunds einen entscheidenden Vorteil: sie sind wahnsinnig bequem. Man muss gar nicht mehr nachdenken, wie etwas funktioniert oder wie man in dieser oder jener Situation handeln soll. Es ist in Fleisch und Blut übergegangen, und das erspart Zeit, Nerven und vielleicht sogar Geld.
Hast du eine Ahnung, wie viel Energie es eine Person kosten kann, etwas anders zu machen, als sie es von Kind auf gelernt hat? Sie muss ihre Komfortzone verlassen und sich womöglich sogar einen Fehler eingestehen, den sie jahrelang vollzogen hat. Darüber hinaus muss sie sich einer neuen Herausforderung stellen, und egal, wie groß oder wie klein diese auch sein mag, es ist und bleibt etwas, mit dem sie sich auseinandersetzen muss. Und das ist vielen von uns nicht immer lieb.
Stell dir einen Kettenraucher vor, der seit jeher seine Zigaretten mit dem Auto holt. Denkst du, es würde ihm leichtfallen, für seinen Einkauf auf das Rad umzusteigen oder gar mit dem Rauchen aufzuhören? Denk an eine begeisterte Fleischesserin, die seit Jahrzehnten täglich Wurst, Speck, Koteletts und Würstel konsumiert. Wie schwierig wäre es wohl für sie, nur noch einmal pro Woche Fleisch zu essen? Sie müsste ihr Kochverhalten komplett umstellen, sich einen Plan für die Mittagspausen machen und könnte in ihrem Stammlokal nur noch die Gemüselaibchen aus dem Tiefkühler »genießen«.
Oder denk etwa an eine deutschsprachige Familie, die seit einem Jahrzehnt mindestens einmal jährlich in den Urlaub nach Mallorca fliegt. Sie kennt jeden Winkel der Insel, hat längst ihre Lieblingsrestaurants gewählt und fühlt sich wie daheim. Die Kinder haben sogar schon Freunde gefunden und sprechen ein paar Worte Spanisch. Es fiele dieser Familie bestimmt alles andere als leicht, auf einmal mit dem Zug an die Nordsee zu fahren und dort Urlaub zu machen. Was für ein Aufwand, die Zugverbindungen zu recherchieren, sich mit einer neuen Region vertraut zu machen und sich auf unbekannte Wetterverhältnisse einstellen zu müssen. Das alles ist kein leichtes Unterfangen, denn der innere Schweinehund liebt Gewohnheiten und ändert nur ungern seine vertrauten Routinen. »Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht«, diese alte Volksweisheit trägt viel Wahres in sich und beschreibt die Liebe zu unseren Gewohnheiten nur zu gut.
Ausreden für den Selbstwert
Was also tun, wenn man weiß, dass man etwas ändern sollte, sich aber einfach nicht dazu durchringen kann? Richtig, man findet Rechtfertigungen und wird in Sachen Ausreden so richtig kreativ und erfinderisch! Denn wenn nicht, wird die innerlich wahrgenommene Widersprüchlichkeit zwischen Wissen, Werten und Handlungen irgendwann unerträglich.
Dieses als »kognitive Dissonanz« bezeichnete Phänomen führt sehr schnell zu inneren Spannungen, die wir möglichst rasch überwinden wollen. In solchen Fällen sind also Ausreden, Scheinlösungen und hausgemachte Illusionen das Mittel der Wahl für unseren inneren Schweinehund. Typische Sager sind etwa:
»Ach was, es ist doch alles gar nicht so schlimm, wie es aussieht.«
»Die Politiker sind es, die handeln müssen!«
»Es ist mir viel zu teuer, Biomilch zu kaufen.«
»Wieso soll ich mich einschränken, ich zahl schon genug Steuern für den Sozialstaat.«
»Jetzt habe ich so viel Geld in das neue Auto investiert, jetzt möchte ich es auch ordentlich nutzen.«
»Was kann ich allein denn schon groß verändern? Mein eigenes Verhalten spielt doch ohnehin keine Rolle.«
Wir reden das Problem klein, ziehen uns aus der Verantwortung und stellen andere oder auch uns selbst einfach als unfähig dar. Die Psychologie nennt dieses Phänomen »Self-Serving Denials«, also Selbstschutz-Behauptungen oder selbstwertdienliche Ausreden. Nehmen wir als Beispiel ein gescheitertes Unternehmen her. Im Konkursfall argumentieren die Eigentümer gern, dass das Management wohl versagt haben müsse. Das Management selbst ortet die Gründe bei der Konkurrenz, den Zulieferern oder der Belegschaft, während die Mitarbeiter wiederum dazu tendieren, dem Management und der Aktionärsversammlung die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und sieht man noch etwas genauer hin, wird man auch welche finden, die den Konkurs ohnehin schon immer vorausgesehen haben und nun froh sind, sich endlich was Neues suchen zu können. So finden alle Beteiligten die passende Ausrede, um durch das Scheitern nicht am eigenen Selbstwert zweifeln zu müssen. Das ist wirklich eine grandiose Strategie, um sich selbst auszutricksen, sich wieder besser zu fühlen und letztlich auch nichts an sich selbst verändern zu müssen!
Alibi-Aktionen für das gute Gewissen
Eine andere Strategie, um sich und sein Verhalten nicht ändern zu müssen, sind die sogenannten Alibi- oder Jo-Jo-Aktionen. Anstatt etwas grundsätzlich zu verändern, tut man einfach so, als würde man sich nachhaltig verhalten. Bei den Alibi-Aktionen sucht man sich etwa im ganz kleinen Rahmen eine nachhaltige Verhaltensänderung, die leicht zu bewerkstelligen ist und einem nicht wehtut. Dies hilft darüber hinweg, bei den großen Problemen nicht wirklich hinsehen zu müssen und trotzdem ein gutes Gefühl zu behalten.
Eine Alibi-Aktion ist zum Beispiel, wenn du die Kartonummantelung eines Joghurtbechers sorgfältig abnimmst und mit dem Altpapier trennst, aber täglich mit deinem SUV in den Supermarkt um die Ecke fährst und exotische Früchte aus aller Herren Länder kaufst. Oder wenn du dem Bettler auf der Straße gern mal einen Euro schenkst, gleichzeitig aber Lohndumping bei deinen Mitarbeitern betreibst und in Verhandlungen um jeden Cent feilschst.
Der Jo-Jo-Effekt wiederum beschreibt die negative Rückkopplung von zuvor gesetzten Maßnahmen. Die meisten von uns haben den Jo-Jo-Effekt bei sich selbst oder im Bekanntenkreis sicherlich schon beobachten können. Zum Beispiel, wenn jemand eine Diät zur Gewichtsabnahme macht. Zuerst wird eine Woche lang gefastet und auf alles Mögliche verzichtet. Doch weil dieser Verzicht so schwerfällt, wird im Anschluss in gewohntem Maße weitergegessen, und das Gewicht schlägt sofort wieder nach oben aus. Dies führt zur nächsten Diät inklusive anschließenden Fressattacken. Und wenn man das Ganze ein paar Mal wiederholt, verhält sich das Gewicht ähnlich einem Jo-Jo, es pendelt ständig auf und ab. Das ist nicht nur nervig, sondern sogar gefährlich. Studien aus den USA und Deutschland zeigen, dass eine oftmalige Gewichtsschwankung Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördert und schlimmere gesundheitliche Auswirkungen hat als das Übergewicht selbst. 35
Читать дальше