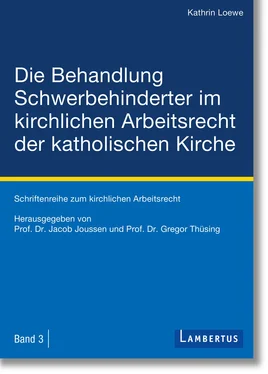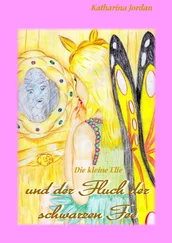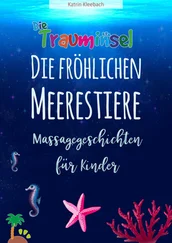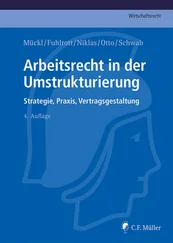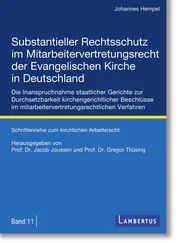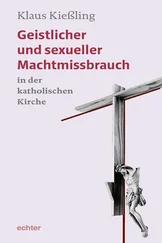B. Staatliches Arbeitsschutzrecht
Der Bereich des Arbeitslebens wird für alle Arbeitnehmer vom staatlichen Gesetzgeber einem besonderen Schutz unterstellt: dem Arbeitsrecht. Dieses dient primär dem Schutz der abhängig Beschäftigten. 74In einem Arbeitsverhältnis wird der Arbeitnehmer vor Benachteiligungen, gesundheitlichen Gefährdungen sowie Arbeitsplatzverlust durch das Arbeitsrecht geschützt. 75Für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis gibt der staatliche Gesetzgeber ebenfalls Ziele und Maßnahmen vor. Diese bilden insgesamt das Arbeitsschutzrecht.
Vor Gefahren am Arbeitsplatz stellt der Staat mit dem sogenannten Arbeitsschutzrecht einen speziellen gesetzlichen Schutz sicher und überlässt insofern die Geltendmachung von Rechten nicht allein dem abhängig Beschäftigten oder seiner Interessenvertretung. Zu diesem Arbeitsschutz im engeren Sinne gehören beispielsweise das Mutterschutzgesetz (MuSchG) und auch das SGB IX, das den Kreis der schwerbehinderten Menschen besonders schützt. 76
1.Geschichtliche Entwicklung und Gegenstand des Arbeitsschutzrechts
Die Geschichte des Arbeitsschutzrechts steht in unmittelbaren Zusammenhang mit der Ende des 18. Jahrhunderts aufkommenden Industrialisierung in Deutschland. Durch sie stieg die Quote der Kinderarbeit rapide, was zu einer Gesundheitsgefährdung der Kinder und letztlich zum Anstieg der Untauglichkeitsquote von jungen Männern beim Militär führte. Es wurde daraufhin vom preußischen Staatsministerium am 09.03.1839 das „ Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken “ geschaffen, das als erste Vorschrift des Arbeitsschutzrechts angesehen wird. 77Mit dem „ Gesetz, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung “ 78von 1891 wurden in der Gewerbeordnung, die erstmals 1869 in Kraft gesetzt worden war, die Voraussetzungen für eine schnellere Weiterentwicklung des Arbeitsschutzrechts erschaffen. Es enthielt Ermächtigungsnormen zum Erlass von Rechtsverordnungen neu bzw. verändert. 79Diese wurden in den Jahren 1893 bis 1914 auch intensiv genutzt und insgesamt 34 Arbeitsschutzvorschriften als Reichsrecht erlassen. Am 06.07.1884 trat zudem das Unfallversicherungsgesetz zur Absicherung der Geschädigten vor finanzieller Not in Kraft. 80Zur Zeit der Weimarer Republik wurde im Jahr 1928 ein umfassendes Arbeitsschutzgesetz entworfen, das allerdings aus politischen Gründen nicht verabschiedet werden konnte. 81Es blieb vorerst bei den zahlreichen Einzelvorschriften. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden bestehende Arbeitsschutzvorschriften ergänzt und abgeändert, aber auch zu einem großen Teil außer Kraft gesetzt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden diese Einschränkungen aber wieder aufgehoben und Regelungen im Bereich des sozialen Arbeitsschutzes neu gefasst, wie etwa das Mutterschutzgesetz und das Schwerbeschädigtengesetz. 82Erst ab 1968 kam es dann zu einer flächendeckenden Arbeitsschutzrechtsreform, bei der alle bestehenden Arbeitsschutzvorschriften außer Kraft gesetzt und in flächendeckende, neue Rechtsvorschriften übernommen wurden, wie etwa die Arbeitsstättenverordnung. 83
Wie schon an der geschichtlichen Entwicklung erkennbar, ist das Arbeitsschutzrecht ein ungeordnetes „ Konglomerat buntscheckiger Normen “ 84. Der staatliche Gesetzgeber hat in ihnen dem Arbeitgeber Pflichten gegenüber der Staatsgewalt auferlegt und damit im Interesse der Allgemeinheit gehandelt. Zum Arbeitsschutzrecht gehören demgemäß all diejenigen Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmerschaft, deren Einhaltung behördlich überwacht wird oder die straf- bzw. ordnungsrechtlichen Sanktionen unterliegen. 85Grundsätzlich ist das Arbeitsschutzrecht im engeren Sinn dem öffentlichen Recht zuzuordnen und umfasst Regelungen mit dem Ziel, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten, unabhängig davon, ob der betroffene Arbeitnehmer sein Recht aktiv verfolgt. 86Die Vorschriften sind zum Teil abwehrender Natur gegen mögliche Gefahren, Belastungen und Nachteile, und zum Teil soll durch sie gestaltend in die bestehende Arbeitsplatzsituation eingegriffen werden, um beispielsweise einen Arbeitsplatz oder Arbeitsabläufe möglichst menschengerecht zu machen. 87Ein entscheidender Ansatz des Arbeitsschutzes ist es, zur optimalen Zielerreichung präventionsorientiert zu handeln, um einen möglichen Schaden von vornherein zu vermeiden. Dabei gilt es nicht nur, spontane Verletzungen und plötzliche Erkrankungen zu verhüten, sondern vor allem auch Gesundheitsbeeinträchtigungen, die durch lang anhaltende Überbeanspruchung oder durch ständiges Einwirken von Arbeitsstoffen nach und nach eintreten, wie etwa Berufskrankheiten. 88
2.Rechtliche Gliederung des Arbeitsschutzrechts
a.Verfassungsrechtliche Grundlagen
Die verfassungsrechtliche Grundlage des Arbeitsschutzrechts ist an Art. 1 Abs. 1 (Schutz der Menschenwürde), Art. 2 Abs. 2 (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) und Art. 20 Abs. 1 GG (Sozialstaatsprinzip) festzumachen 89, da das Grundgesetz abgesehen von Art. 74 Nr. 12 GG, der die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes vorschreibt, keine Bestimmungen enthält, die sich speziell auf den Arbeitsschutz beziehen. Diese Grundrechte sind nicht nur subjektive Abwehrrechte jedes Einzelnen gegenüber dem Staat, sondern nach der Rechtsprechung des BVerfG folgt aus diesen Grundrechtsbestimmungen auch eine Verpflichtung des Gesetzgebers, Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer zu erlassen. 90Denn bei einer ungleichen Kräfteverteilung wie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen staatliche Regelungen auch im Bereich des Vertragsrechts ausgleichend eingreifen, um den Grundrechtsschutz zu sichern. 91Dies kann in Form öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Pflichten erfolgen. Staatliche Regelungen sind auch für die Privatautonomie unerlässlich, um dem sozialen und wirtschaftlichen Ungleichgewicht entgegenzuwirken und damit die Voraussetzungen für eine rechtsgeschäftliche Ordnung zu schaffen. 92Allerdings muss dieser Schutz nicht so weit gehen, dass die Arbeitswelt als risikofreie Zone gebildet werden müsste, denn so würde möglicherweise auch die gewissenhafte Nutzung der fortschrittlichen Technik schon von vornherein ausgeschlossen. 93
b.Dualer Aufbau
Das öffentlich-rechtliche Arbeitsschutzrecht in Deutschland ist von seinem dualen Aufbau geprägt. Es entfällt in folgende zwei Gruppen: das staatliche Arbeitsschutzrecht und das öffentlich-rechtliche, autonome oder auch unfallversicherungsrechtliches Arbeitsschutzrecht genannt. 94Letzteres ist durch das Siebte Sozialgesetzbuch (SGB VII) geregelt und wird durch die Unfallversicherungsträger wahrgenommen. Diese sind in erster Linie Berufsgenossenschaften sowie Gemeinde- und Eigenunfallversicherungsträger. 95Aufgabe der Unfallversicherung ist es, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden bzw. nach Eintritt eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit, die Gesundheit des Betroffenen wiederherzustellen § 1 SGB VII. Der Arbeitsschutz wird hier durch mittelbare Staatstätigkeit wahrgenommen, indem der Staat die Regelungskompetenzen der Unfallversicherungsträger in diesem Bereich durch das SGB VII festgelegt hat.
Im Bereich des staatlichen Arbeitsschutzrechts schafft der Staat Gesetze und sichert ihre Einhaltung durch staatliche Ämter für Arbeitsschutz bzw. Gewerbeaufsichtsämter. 96Man unterscheidet zwischen dem technischen und dem sozialen Arbeitsschutz. Ersterer lässt sich systematisch wiederum in Vorschriften den betrieblichen Arbeitsschutz betreffend und in Regelungen einteilen, die den produktbezogenen Gefahrenschutz angehen. Wichtige Gesetze sind dabei das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), das SGB VII und das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (PSG). Der soziale Arbeitsschutz umfasst neben dem Arbeitszeitschutz nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) auch den Schutz bestimmter Personengruppen im Arbeitsleben, wie beispielsweise werdende Mütter im Mutterschutzgesetz (MuSchG), Jugendliche im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) oder eben den Schutz schwerbehinderter Menschen nach dem SGB IX. 97 98
Читать дальше