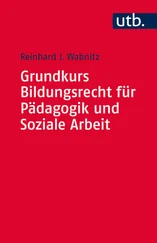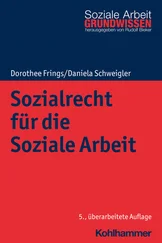4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten unter 25-jährigen Kinder der in den Nummern 1 bis 3 Genannten, soweit sie die Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen können (§ 7 Abs. 3 SGB II).
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Für die Bildung einer BG reicht ein eLb aus (auch wenn § 7 Abs. 3 Nr. 1 SGB II – insofern missverständlich – von „den eLb“ spricht). Darüber hinaus gehören alle Personen, die mit einem „Hauptleistungsberechtigten“ (BSG NZS 2009, 634 Rn. 24) in einer der in § 7 Abs. 3 Nrn. 2–4 SGB II umschriebenen Beziehung (Partner, Eltern, Kinder) stehen, zu einer BG. Damit können auch mehrere eLb zu einer BG gehören.
Eltern
Die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines unverheirateten erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, bilden mit ihrem Kind eine BG (§ 7 Abs. 3 Nr.2 SGB II). Dies gilt auch dann, wenn sie selbst erwerbsfähig sind (BSG NZFam 2014, 1060 [Leits. 1]).
Partnerinnen und Partner
Partner sein können nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten oder nicht dauernd getrennt lebende (eingetragene gleichgeschlechtliche) Lebenspartner nach LPartG. Eine nur vorübergehende räumliche Trennung (BSG NJOZ 2014, 675, 676 [Untersuchungshaft]) oder – umgekehrt – ein einvernehmliches Lebensmodell, das eine häusliche Gemeinschaft überhaupt nicht vorsieht (BSG NJW 2013, 957, 960), schließen eine BG damit nicht aus.
Schwieriger ist es, das Vorliegen einer „Verantwortungs- und Einstandsgemeinschaft“ i.S.d. § 7 Abs. 3 Nr. 3 c SGB II festzustellen. Das BSG hat hierfür Kriterien aufgestellt (BSG NJW 2013, 957, 958), die in der Übersicht 18 zusammengefasst sind.
Übersicht 18
Eine Verantwortungs- und Einstandsgemeinschaft i.S.d. § 7 Abs. 3 Nr. 3 c SGB II liegt vor, wenn
1. Partner (= eine Beziehung, die keine vergleichbare Lebensgemeinschaft daneben zulässt)
2. in einem gemeinsamen Haushalt (= „Wirtschaften aus einem Topf“) so zusammen leben, dass
3. von einem gemeinsamen Willen ausgegangen werden kann, füreinander Verantwortung zu tragen und füreinander einzustehen
4. Die letzte Voraussetzung wird bei Vorliegen einer der in § 7 Abs. 3 a SGB II aufgezählten Kriterien vermutet.
Kinder
In die Bedarfsgemeinschaft gehören auch die dem Haushalt angehörenden unverheirateten leiblichen und Adoptivkinder der in § 7 Abs. 3 Nr. 1–3 SGB II genannten Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und ihren Unterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sichern können. Ob letzteres der Fall ist muss durch eine auf das Kindereinkommen und -vermögen bezogene Prüfung festgestellt werden. Wenn Kinder getrennt lebender Eltern sich abwechselnd und mit einer gewissen Regelmäßigkeit für jeweils länger als einen Tag im Haushalt des anderen Elternteils aufhalten, sieht das BSG eine zeitweise (temporäre) BG als gegeben an (BSG NZS 2007, 383, 387). Dies gilt auch, wenn die Kinder ihren Wohnsitz oder gA im Ausland haben (z.B. bei den Großeltern) und nur die Ferien bei ihren Eltern im Bundesgebiet verbringen (BSG NDV-RD 2015, 62 ff.).
3.1.3 Leistungsrechtliche Konsequenzen der Zugehörigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft
Die Rechtsfigur der Bedarfsgemeinschaft lässt „ bei Vorliegen bestimmter typisierter (familiär geprägter) Lebensumstände auf (typisierte) Haushaltseinsparungen und Unterstützungsleistungen innerhalb der Gemeinschaft [schließen], die die Gewährung staatlicher Hilfe nicht oder nur noch in eingeschränktem Umfang gerechtfertigt erscheinen“ lässt (BSG U v. 14.3.2012 – B 14 AS 17 / 11 R – juris-Dokument 23). Die leistungsrechtlichen Konsequenzen einer BG können Sie der Übersicht 19 entnehmen.
Übersicht 19
Leistungsrechtliche Konsequenzen der Zugehörigkeit zu einer BG
1. Die Höhe des Regelbedarfs hängt von der Zugehörigkeit zu und Stellung in einer BG ab ( Kap. 4).
2. Das Einkommen und Vermögen von Partnern wird wechselseitig bei der Bedarfsdeckung berücksichtigt ( Kap. 9).
3. Das Einkommen und Vermögen von Eltern / Elternteilen und deren Partnern wird bei bedarfsgemeinschaftsangehörigen Kindern bedarfsdeckend berücksichtigt ( Kap. 9).
3.2 Leistungsausschlüsse nach dem SGB II
Der Gesetzgeber hat aus den unterschiedlichsten Motiven Personengruppen von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen, selbst wenn diese die Leistungsvoraussetzungen nach dem SGB II ( Kap. 3.1) erfüllen.
3.2.1 Ausländische Staatsangehörige
§ 7 Abs. 1 S. 2 SGB II dient der Steuerung der durch Zuwanderung hervorgerufenen Inanspruchnahme von Sozialleistungen. Nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1 SGB II sind alle Ausländerinnen und Ausländer für die ersten 3 Monate ihres Aufenthaltes im Bundesgebiet generell von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen. Nicht davon betroffen sind
• Staatsangehörige der Europäischen Union („Unionsbürger“), die als Arbeitnehmer oder Selbständige im Bundesgebiet bereits freizügigkeitsberechtigt sind (§ 2 Abs. 3 FreizügG / EU);
• Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel nach Kap. 2Abschn. 5 AufenthG im Bundesgebiet aufhalten (§ 7 Abs. 2 S. 3 SGB II).
Im Anschluss an die ersten 3 Monate des Aufenthalts sind weiterhin alle Ausländer von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt (§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr.2 SGB II). Da nur Unionsbürger zur Arbeitsuche in das Bundesgebiet einreisen dürfen, betrifft dieser Ausschlusstatbestand in der Praxis nur diese. Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG (hierzu Kap. 13) sind ebenfalls von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen (§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr.3 SGB II).
3.2.2 Auszubildende
Auszubildende in einer dem Grunde nach förderungsfähigen Ausbildung nach dem BAföG sind von Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen (§ 7 Abs. 5 SGB II). Dabei genügt für den Leistungsausschluss die Förderungsfähigkeit dem Grunde nach, Leistungen müssen nicht tatsächlich bezogen werden. Der Ausschluss greift auch dann ein, wenn die nach dem BAföG dem Grunde nach förderungsfähige Ausbildung lediglich aus individuellen Versagensgründen (Überschreitung der Altersgrenze, Zweitausbildung) nicht gefördert wird (BSG FEVS 61, 104, [Leits. 1]). Der Leistungsausschluss gilt jedoch nur für ausbildungsbedingte Bedarfe. Zu anderen Bedarfen vgl. Kap. 7.
3.2.3 Sonstige Ausschlusstatbestände
§ 7 SGB II enthält in seinen Abs. 4 und 4a weitere folgende Ausschlusstatbestände.
Vollstationäre Unterbringung
Bei vollstationär untergebrachten Hilfebedürftigen wird deren Erwerbsunfähigkeit rechtlich fingiert, da in Einrichtungen die „Gesamtverantwortung für die tägliche Lebensführung“ so weit an die Einrichtung abgegeben wurde, dass der Hilfebedürftige nicht mehr drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann (BSGE 116, 112 [Leits.]). Der Aufenthalt in einer Einrichtung zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung (Strafhaft, Untersuchungshaft, Unterbringung psychisch Kranker und Suchtkranker nach den Unterbringungsgesetzen der Länder) ist einem Einrichtungsaufenthalt rechtlich gleichgestellt (§ 7 Abs. 4 S. 1 1. Alt, S. 2 SGB II). Bei Einrichtungsunterbringung gibt es allerdings gesetzliche (Rück-)Ausnahmen für den Fall eines Krankenhausaufenthaltes unter 6 Monaten sowie bei einer tatsächlichen Erwerbstätigkeit unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts von mind. 15h / Woche trotz vollstationärer Einrichtungsunterbringung (§ 7 Abs. 4 S. 3 SGB II).
Rentenbezug
Der Leistungsausschluss gilt für die Bezieher einer (vorgezogenen) Altersrente oder vergleichbarer Leistungen (§ 7 Abs. 4 S. 1 2.–4. Alt. SGB II), da dieser Personenkreis endgültig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist und nicht mehr in Arbeit eingegliedert werden kann.
Читать дальше