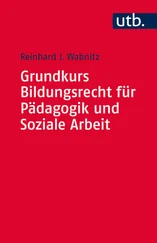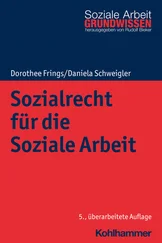Übersicht 15
Besonderheiten beim Verwaltungsverfahren nach dem SGB II
1. sofortige Vollziehbarkeit von Verwaltungsakten – ohne aufschiebende Wirkung bei Widerspruch und Klage (§ 39 SGB II)
2. „Untergang“ von Leistungsansprüchen bereits nach einem Jahr (§ 40 Abs. 1 S. 2 SGB II) gegenüber dem sonst vorgesehenen VierJahres-Zeitraum (gem. § 44 Abs. 4 SGB X)
3. Möglichkeit der vorläufigen Zahlungseinstellung (§ 40 Abs. 2 Nr. 4 SGB II)
4. besondere Informations- und Mitwirkungspflichten (zusätzlich zu den §§ 60 ff. SGB I) von Antragstellern, Leistungsberechtigten, Arbeitgebern und ggf. Dritten, ggf. mit Schadenersatzverpflichtungen (§§ 56 bis 62 SGB II)
5. einheitliches Feststellungsverfahren betreffend Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit (§ 44a SGB II).
 Literatur
Literatur
Patjens, R./Patjens, T. (2018): Sozialverwaltungsrecht für die Soziale Arbeit. 2. Aufl. Nomos, Baden-Baden
Reinhardt, J. (2019): Grundkurs Sozialverwaltungsrecht für die Soziale Arbeit. 2. Aufl. Reinhardt, München
2.4 Der praktische Fall: Wer ist zuständig für die Grundsicherung?
1 Familie F will „Stütze beantragen“ und hat gehört, dass dafür nicht mehr das Sozialamt zuständig sei, sondern ein „Träger der Grundsicherung“. Familie F fragt die in der Nachbarschaft lebende Studentin der Sozialen Arbeit S, wer denn dies nun sei.
2 Jetzt ist auch Studentin S verwirrt. Welche Aufgaben hat denn eine „Gemeinsame Einrichtung“?
3 Familie F beantragt daraufhin beim zuständigen Jobcenter Grundsicherung für Arbeitsuchende. Zu ihrer Überraschung und Verärgerung wird dieser Antrag jedoch von dort mit einem mit einer Rechtsmittelbelehrung versehenen Bescheid vom 10. des Monats X des Jahres Y abgelehnt. Was kann Familie F dagegen tun?
3Leistungsberechtigung und Leistungen (SGB II)
3.1 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre Bedarfsgemeinschaftsangehörigen
Ziel der Neuordnung der Fürsorgeleistungen im Jahr 2005 ( Kap. 1) war es, die Leistungen an erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) und deren Familienangehörige in einem Leistungsgesetz – dem SGB II – zusammenzufassen. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte haben bei Vorliegen der Voraussetzungen einen Anspruch auf ALG II (§ 19 Abs. 1 S. 1 SGB II). Die Leistung umfasst den Regelbedarf, Mehrbedarfe, den Bedarf für Unterkunft und Heizung sowie für Bildung und Teilhabe (§ 19 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 1 SGB II). Einzelheiten hierzu finden Sie in den Kap. 4, 5und 7.2.
3.1.1 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Wer zu den eLb gehört, hängt von Umständen ab, die der Übersicht 16 zu entnehmen sind.
Übersicht 16
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) sind Personen, die (§ 7 Abs. 1 S. 1 SGB II)
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben,
2. erwerbsfähig sind,
3. hilfebedürftig sind und
4. ih ren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Erwerbsfähigkeit
Die Leistungsvoraussetzung der Erwerbsfähigkeit ist in § 8 Abs. 1 SGB II gesetzlich definiert. Diese Definition durch Verneinung („Erwerbsfähig ist, wer nicht …“) lässt sich besser verständlich positiv formulieren: „Erwerbsfähig ist, wer innerhalb absehbarer Zeit gesundheitlich in der Lage ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.“ (Edtbauer / Kievel 2014, 42) Die Erwerbsfähigkeit wird durch die Agentur für Arbeit festgestellt. Gegen diese Entscheidung kann nur ein anderer Leistungsträger, der aufgrund dieser Entscheidung leistungspflichtig würde (z.B. der Rentenversicherungsträger), Widerspruch einlegen. In diesem Fall ist vor der Entscheidung über den Widerspruch eine gutachtliche Stellungnahme des zuständigen Rentenversicherungsträgers einzuholen (§ 44 a Abs. 1 SGB II).
Als „absehbare Zeit“ in diesem Sinne ist ein Zeitraum von bis zu sechs Monaten anzusehen (BA-FW zu § 8 Rn. 8.2). Wichtig ist, dass nur gesundheitliche Einschränkungen (Krankheit, Behinderung) Einfluss auf die Erwerbsfähigkeit haben können. Kindererziehung, Schul- oder Berufsausbildung, Wohnungslosigkeit, Analphabetismus, Sprachprobleme oder andere „soziale Einschränkungen“ sind ohne Relevanz für die Beurteilung der Erwerbsfähigkeit. Der allgemeine Arbeitsmarkt umfasst alle denkbaren Erwerbstätigkeiten außerhalb von Sonderarbeitsmärkten wie dem der Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (LPK SGB II / Armborst, 2021, SGB II Rn. 13).
Nach § 8 Abs. 2 SGB II können ausländische Staatsangehörige nur erwerbstätig i.S.d. Abs. 1 sein, wenn ihnen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist oder erlaubt werden könnte. Staatsangehörigen der Mitgliedsstaaten der EU ist die Aufnahme einer Beschäftigung generell erlaubt. Staatsangehörigen anderer Staaten („Drittstaatsangehörige“) ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nur erlaubt, wenn sich die Arbeitserlaubnis aus deren Aufenthaltserlaubnis ergibt.
Hilfebedürftigkeit
Entsprechend dem Charakter der SGB II-Leistungen als Fürsorgeleistungen werden Leistungen nur im Falle von Hilfebedürftigkeit erbracht (§ 9 Abs. 1 SGB II), d. h. in der Höhe, in der der festgestellte Bedarf nicht durch vorhandene Eigenmitteln gedeckt werden kann (vgl. § 19 Abs. 3 S. 1 SGB II). Hier kommt der grundsätzliche Nachrang von SGB II-Fürsorgeleistungen gegenüber jeglicher privater oder staatlich organisierter sonstiger Hilfe (§ 5 Abs.1 S. 1 SGB II) zum Ausdruck. Mehr dazu in Kap. 8.
Gewöhnlicher Aufenthalt
Die letzte Voraussetzung ist der gewöhnliche Aufenthalt (gA) im Bundesgebiet. Seinen gA hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt (§ 30 Abs. 3 S. 2 SGB I). Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass am angemeldeten Wohnsitz auch der gewöhnliche Aufenthalt begründet wird. Die Frage des gewöhnlichen Aufenthaltes stellt sich damit allenfalls für Personen, die nicht schon über die Bestimmung des Wohnsitzes erfasst sind, also typischerweise Wohnungslose und Auslandsdeutsche (BA-FW zu § 7 Rn. 7.2).
3.1.2 Personen, die mit einer erwerbsfähigen Person in Bedarfsgemeinschaft leben
Leistungen erhalten auch Personen, die mit eLb in einer Bedarfsgemeinschaft (BG) leben (§ 7 Abs. 2 S. 1 SGB II) (Übersicht 17). Mit dieser Regelung ist grundsätzlich auch (noch) nicht erwerbsfähigen Personen der Zugang Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II eröffnet. Das Gesetz stellt keine weiteren Leistungsvoraussetzungen auf, sodass das Fehlen eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland dem Anspruch auf Sozialgeld eines nichterwerbsfähigen Leistungsberechtigten, der mit einem eLb in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, nicht entgegensteht (BSG NDV-RD 2015, 62 [Leits.]).
Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Sozialgeld (§ 19 Abs. 1 S. 2 SGB II), wobei die Inhalte dieser Leistung denjenigen des ALG II gleichen.
Übersicht 17
Zur Bedarfsgemeinschaft gehören
1. die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,
2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines unverheirateten erwerbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und die im Haushalt lebende Partnerin oder der im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils,
3. als Partnerin oder Partner der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
a) nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten,
b) nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartnerin oder Lebenspartner,
c) eine Person, die mit der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen.
Читать дальше

 Literatur
Literatur