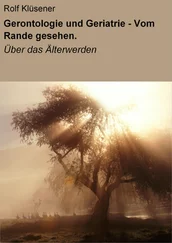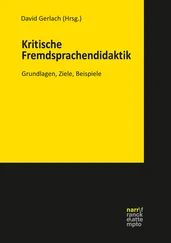Schroeter, K. R. (2021). Auf der Suche nach Interdisziplinarität – ›per aspera ad astra‹ oder ein Weg in den Zaubergarten wissenschaftlicher Illusionen? In J. Hahmann, K. Baresel, M. Blum & K. Rackow (Hrsg.), Gerontologie gestern, heute und morgen: Multigenerationale Perspektiven auf das Alter(n) (S. 15–57). Wiesbaden: Springer VS.
Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom. Harmondsworth: Penguin.
Townsend, P. (1981). The structured dependency of the elderly: A creation of social policy in the twentieth century. Ageing and Society, 1, 5–28.
Townsend, P. & Wedderburn, D. (1965). The Aged in the Welfare State. London: Bell.
Walker, A. (1980). The social creation of poverty and dependency in old age. Journal of Social Policy, 9(1), 49–75.
Walker, A. (1981). Towards a political economy of old age. Ageing and Society, 1(1), 73–94.
Young, D. (1941). Memorandum on suggestions for research in the field of Social Adjustment. American Journal of Sociology, 46(6), 873–886.
4Alle in diesem Kapitel vorgenommenen Übertragungen der englischsprachigen Originalzitate ins Deutsche stammen vom Autor.
5Mit Mainstream-Gerontologie oder instrumenteller Gerontologie bezeichnet Moody (1988b, S. 33) einen »Bereich der konventionellen sozialwissenschaftlichen Forschung, der zur Reifizierung des Status quo und der Bereitstellung neuer Werkzeuge zur Vorhersage und Kontrolle menschlichen Verhaltens dient. Die Hegemonie der instrumentellen Gerontologie dient auch dazu, professionelle Interventionen zu legitimieren, die ein Herrschaftsmuster sowohl in der Theorie als auch in der Praxis des bürokratischen Staates verstärken.«
6Zur Rolle Cowdrys bei der Entstehung des wissenschaftlichen Feldes der Gerontologie vgl. Achenbaum, 1995, S. 64–75; Katz, 1996, S. 93–103; Park 2008.
7»There is a problem and one of scope having no precedent in human history. Biological processes are at the roots of the problems and of the methods of solving them, but the biological processes take place in economic, political, and cultural contexts. They are inextricably interwoven with these contexts so that one reacts upon the other in all sorts of intricate ways. We need to know the ways in which social contexts react back into biological processes as well as to know the ways in which the biological processes condition social life. This is the problem to which attention is invited.« (Dewey, 1939, xxvi, zit. nach Achenbaum, 1995, S. 72)
8Wann genau das Label ›Kritische Gerontologie‹ erstmals auftrat und von wem es gewissermaßen in geistiger Urheberschaft erstmals eingeführt wurde, ist mir nicht bekannt. Frühe Überlegungen dazu wurden gewiss von Marshall und Tindale (1978) in ihrem Beitrag zur Radikalen Gerontologie formuliert. Auch bei Estes (1979) ist bereits im Vorwort von Aging Enterprise davon die Rede, dass die Autorin derzeit an zwei weiteren Büchern zu »critical perspectives on gerontology« arbeite, der Begriff ›critical gerontology‹ tritt dort aber nicht auf. Noch bevor Phillipson und Walker (1987), Moody (1988b) und Baars (1991) ihre ersten Einsichten in die Kritische Gerontologie formulierten, hatte Sally Gadow (1983) den Begriff ›kritische Gerontologie‹ bereits im Titel ihres Beitrages über die Entwicklung eines Curriculums für einen Kurs ›Philosophie und Altern‹ für Studierende der Gerontologie an der University of Florida geführt, ohne dabei allerdings näher zu explizieren, was Kritische Gerontologie genau sei.
9Gouldner (1968, S. 111) argumentiert, dass sich ›radikale‹ Soziologen von ›liberalen‹ Soziologen dadurch unterscheiden, dass sie zwar den Standpunkt des Underdogs einnehmen, ihn aber auf die Untersuchung von Overdogs anwenden. Während die liberalen Soziologen ihren Fokus auf die Underdogs und Opfer und deren bürokratische Verwalter legen, geht es den radikalen Soziologen um die Untersuchung der Machtelite.
10Vgl. u. a. Estes (1979), Guillemard (1977, 1983), Minkler & Estes (1984, 1991), Myles (1980, 1984), Phillipson (1982), Phillipson & Walker (1986), Quadagno (1984, 1988), Townsend (1979, 1981), Townsend & Wedderburn (1965) sowie Walker (1980, 1981); weitere Referenzen für die theoretische Arbeit zu Alter und Staat finden sich u. a. bei Estes (2001a, S. 19ff.).
11Wie sehr solche Lesarten von den historisch-kontextuellen Rahmungen abhängen, zeigt sich u. a. daran, dass in Deutschland eine Vorruhestandsregelung mit weitaus größerer Bereitschaft angenommen wurde als etwa in Großbritannien (vgl. Kohli, 1988, S. 375ff., S. 391 Anm. 41).
12Die Ebene des Sex-/Gender-Systems wurde von Estes erst in einer späteren Version hinzugefügt (Estes, 2001c).
13Vgl. in diesem Zusammenhang auch Cohen (1994). Cohen ordnet seinen ›geroanthropologischen‹ Beitrag über »Old Age: Cultural and Critical Perspectives« selbst der Kritischen Gerontologie zu und schlägt drei Richtungen vor, in denen sich die Anthropologie kritisch mit der Erforschung des Alters befassen soll: »einen phänomenologischen Fokus auf Erfahrung, Verkörperung und Identität; einen kritischen Fokus auf die Rationalitäten und Hegemonien, durch die das Altern erfahren und repräsentiert wird; und einen interpretativen Fokus auf die Untersuchung der Relevanz des Alters des Ethnographen für die Formen des produzierten Wissens« (Cohen, 1994, S. 151f.).
14Mit dem Terminus gerontological imagination ist im weitesten Sinne ein Ideengerüst oder ein gerontologisches Paradigma in statu nascendi gemeint, das nach Ferraro (2006, 2018) insgesamt sieben Grundsätze – oder Axiome – des gerontologischen Denkens umfasst, die als allgemeine Merk- oder Lehrsätze zu lesen sind: 1. Altern und Kausalität, 2. Altern als vielschichtige Veränderung, 3. Genetische Einflüsse auf das Altern, 4. Altern und Heterogenität, 5. Altern und Lebensverlaufsanalyse, 6. Altern und kumulative Benachteiligung, 7. Altern und Ageismus.
15Vgl. dazu auch die von Moody (2010) vorgestellten Organisationen des New Ageing Enterprise.
3 Zu den Prämissen Kritischer Gerontologie
Kirsten Aner
Eine Verständigung darüber, was in der vorliegenden Einführung unter Kritischer Gerontologie zu verstehen sein soll, bedürfte streng genommen zunächst sowohl einer Auseinandersetzung mit Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie als auch mit diversen Theorie-Perspektiven, darunter mit der sog. Kritischen Theorie. Beides kann an dieser Stelle nicht geleistet werden. Um dennoch unsere Auswahl der in diesem dritten Kapitel vorgestellten Ansätze nachvollziehbar zu begründen, greifen wir bereits hier auf ein Schlüsseldokument zurück: »The Challenge of Critical Gerontology: The Problem of Social Constitution« (Baars, 1991). In diesem Text wird ein erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Blick auf die Altersforschung geworfen. 16 Mit Hilfe dieser Ausführungen wird verständlich, worin eine wesentliche Gemeinsamkeit der ›kritischen‹ Ansätze besteht (  Kap. 1u.
Kap. 1u.  Kap. 2).
Kap. 2).
3.1 Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie im Kontext der Gerontologie
Ein Ausgangspunkt der Überlegungen von Baars (1991) ist zum einen die Beobachtung, wie mit dem Wissen über das biologische Altern, das jeden Menschen betrifft, der nur lange genug lebt, zugleich das Wissen darüber wuchs, wie diese Prozesse historisch, kulturell und sozial beeinflusst werden. Zum anderen geht Baars davon aus, dass aus eben diesem Wissen eine besondere Verantwortung zur Reflexion des eigenen Beitrags der Gerontologie zu diesen Bedingungen erwächst. Schließlich könne die Gerontologie als Teil dieser Bedingungen verstanden werden; im Gegensatz etwa zur Astronomie, die die Bewegung der Sterne und Planeten nur beschreibt, könne diese Wissenschaft über Änderungen des Laufs der Dinge diskutieren und mitentscheiden, könne z. B. Lebenswelten monopolisieren, indem – explizit oder auch nur implizit – eine spezifische Form des Alterns zum Maßstab erhoben würde (ebd., S. 219f.).
Читать дальше
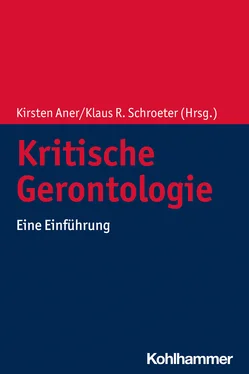
 Kap. 1u.
Kap. 1u.