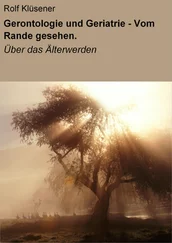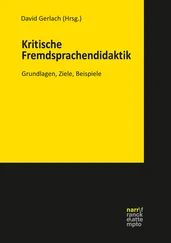Die soziale Konstitution der Gerontologie und des Alterns
Baars betont, dass die Naturwissenschaften zwar keine unsinnigen, willkürlichen Konstrukte produzierten und das experimentelle Vorgehen korrekte Interpretationen nicht ausschließe. Gleichwohl sei »eine pluralistische Interpretation von Objektivität in dem Bewusstsein der involvierten konstitutiven [sozialen; K.A.] Faktoren« (ebd., S. 228) notwendig. Doch auch wenn dies geschehe, bleibe eine entscheidende Differenz zwischen Natur- und Sozialwissenschaften bestehen: Ein sozialer Untersuchungsgegenstand würde eben nicht bloß von den Wissenschaftler/-innen, sondern auch von den Untersuchungsteilnehmer/-innen interpretiert. Die erlangte Information sei von ihnen beeinflusst, weshalb von einer doppelten Konstitution der Sozialwissenschaft(en) zu sprechen sei (ebd.).
Auf der Seite der Wissenschaftler/-innen sieht Baars folgende Faktoren als konstitutiv an: die direkte Interaktion zwischen den Untersuchenden in personenbezogenen Kooperationsnetzwerken; Zitationskartelle/-cluster und einzelne herausragende Gerontolog/-innen, die die Richtung der Theoriebildung und Forschung beeinflussen; Organisationsstrukturen von nationalen Förderprogrammen über Universitäten bis hin zu Herausgeberkreisen; politische-ökonomische Strukturen und Präferenzen und schließlich – und am umfassendsten – das historisch entstandene Selbst- und Organisationsverständnis wissenschaftlicher Arbeit (ebd., S. 228f.). Auf der Seite der soziokulturellen Konstitution von Altern, also des Gegenstands der Gerontologie, sieht Baars das Altern wie folgt konstituiert: auf der Ebene der direkten Beziehungen zwischen Menschen; auf der Ebene von Organisationen, die den Lebenslauf durch ihre altersbezogenen Strategien entscheidend mitbestimmen (als Garanten von Ruhestandsregimes oder als Hilfsorganisationen für ältere Menschen); auf der Ebene der politischen und ökonomischen Prozesse und Strukturen, die wiederum in hohem Maße die Möglichkeiten dieser Organisationen bestimmen; darüber hinaus durch nationale Traditionen der Organisation von Pflege, die sich mit historisch veränderlichen Traditionen im Bereich Altern, Sterben und Tod vermengen (ebd., S. 229).
Insbesondere in entwickelten Ländern beeinflusse diese [komplexe doppelte; K.A.] soziale Konstitution der Gerontologie die soziale Konstitution des Alterns, da die Ergebnisse gerontologischer Forschung die Interpretation und Strukturierung des Alternsprozesses veränderten; man denke nur an die zahlreichen Statistiken, die für Planungen benutzt würden – der medizinischen Versorgung, von Pflegeheimen, Sozialleistungen, Wohnungen, Renteneintrittsalter etc. (ebd.).
Kritik, Konstitution und Gerontologie
Die Übereinstimmung der verschiedenen kritisch-gerontologischen Ansätze sieht Baars (1991, S. 230) darin, dass sie sensibel für die soziale Konstitution gedanklicher Arbeit und ihrer Gegenstände sind (und deshalb vom internalistischen Diskurs ausgeschlossen werden). Allerdings fokussierten sie je unterschiedliche Probleme, Aspekte oder Stufen des Prozesses der sozialen Konstitution. Dies – und die Tendenz, einander nicht gelten zu lassen – liege an divergierenden Traditionslinien der gerontologischen Ansätze, die Baars im Folgenden identifiziert: die klassische kritische Theorie (Adorno, Horkheimer) – die interpretative Tradition (Husserl, Schütz) – Strukturalismus und politische Ökonomie (Marxismus, Neo-Marxismus) – Poststrukturalismus (Foucault). Im Anschluss arbeitet Baars die Grundzüge dieser vier Traditionslinien heraus (ebd., S. 230ff.).
Abschließend versucht Baars, eine Perspektive zu entwickeln, auf welchem Wege die zuvor skizzierten Ansätze miteinander in Beziehung gesetzt werden können und seiner Meinung nach sollten. Er konstatiert, dass sich der generelle Trend in den Kritischen Theorien gewandelt habe: Die großen historischen Perspektiven und Ideen radikalen gesellschaftlichen Wandels seien weniger präsent, hingegen richte sich die Aufmerksamkeit nach wie vor auf die Kritik von Prozessen der Macht (vgl. auch Amann & Kolland, 2014, S. 19). Verschieden artikuliert gehe es um die Art und Weise, in der soziale Systeme und Strukturen Menschen disziplinieren, ihre Körper normalisieren (Foucault), ihre Lebenswelt kolonisieren (Habermas), ihre intersubjektive Kommunikation objektivieren (interpretativer Ansatz) oder soziale Abhängigkeit produzieren (strukturfunktionaler Ansatz) (ebd., S. 235).
Für unseren Zweck, kritisch gerontologische Ansätze auszuwählen, vorzustellen und zu vergleichen, lässt sich zunächst mit Baars (1991) Folgendes festhalten: Die verschiedenen Ansätze kritischer Gerontologie fokussieren – je nach Wissenschaftstradition – unterschiedliche Probleme, Aspekte oder Stufen des Prozesses der sozialen Konstitution. Ihre Gemeinsamkeit liegt in ihrer Sensibilität für die soziale Konstitution ihres Gegenstands und der (Alterns-)Wissenschaft selbst.
3.2 Kritische Gerontologie und Gesellschaft
Mit dem Ziel, kritisch gerontologische Ansätze identifizieren und – über die Zuordnung zu diversen Traditionslinien »externalistischer« Wissenschaft hinaus – miteinander vergleichen zu können, scheint es sinnvoll, stärker noch als Baars ihren Gesellschaftsbezug zu betrachten. Die Forderung nach der Berücksichtigung des gesellschaftlichen Kontextes ist bei Baars zwar angelegt, jedoch nur ansatzweise ausgeführt. Die Spanne kann aus seiner Perspektive grundsätzlich von der bloßen Wahrnehmung des gesellschaftlichen Kontextes über die explizite Thematisierung sozialer Ungleichheit bis hin zur gesellschaftsverändernden Utopie reichen. 21
Zur Begründung einer Weiterführung können wir zunächst auf eine Feststellung von Margret Kuhn zurückgreifen. In einem offenen Brief an die Zeitschrift »The Gerontologist« hatte die damalige Vorsitzende der 1970 gegründeten Grey Panthers Folgendes festgestellt: Eine Gerontologie, die alte, arme und stigmatisierte Menschen zu Objekten ihrer Forschung mache, sie als Problem für die Gesellschaft betrachte statt als Personen, die gesellschaftliche Probleme erleben, suche unweigerlich nach Wegen der Anpassung der Menschen an die Gesellschaft statt nach Wegen, die Gesellschaft so zu humanisieren, dass sie den Bedürfnissen der alten Menschen entspricht (vgl. Kuhn, 1978, S. 422ff.). Folgt man der Forderung von Horkheimer (1988 [1937]), dass ›kritische‹ Wissenschaft sich sowohl des eigenen sozialen Entstehungszusammenhangs als auch ihres praktischen Verwendungszusammenhangs permanent zu vergewissern habe, muss man den offenen Brief dieser politischen Aktivistin ernst nehmen und über die rein methodische Berücksichtigung des Subjektstatus der alten Menschen in der Forschung hinausgehen. Radikal interpretiert läuft ihr Anspruch darauf hinaus, dass alle Gerontolog/-innen politische Intellektuelle werden, die sich mit sozialen Bewegungen verbinden. Jenseits der erkenntnistheoretischen und methodologischen Implikationen einer ›kritischen‹ Wissenschaft hat genau diese Frage nach dem normativen Verhältnis zu sozialen Kämpfen bereits in Horkheimers Zeitschriftenartikel aus dem Jahr 1937 eine Rolle gespielt und die Frankfurter Schule jahrzehntelang begleitet. Ihre Virulenz lässt sich auch in der historischen Entwicklung der Kritischen Gerontologie erkennen (  Kap. 2). Sie kommt zugespitzt in der Position von Dannefer et al. (2008) zum Ausdruck, dass die von der Kritischen Gerontologie – ob auf politisch-ökonomischer oder ideologiekritischer Basis – thematisierten Probleme real existieren und die Anwendung der kritischen Theorie auf diese Probleme voraussetze, »dass man von der kritischen Analyse an sich zu ihrer Anwendung im realen Leben übergeht« (Dannefer et al., 2008, S. 104).
Kap. 2). Sie kommt zugespitzt in der Position von Dannefer et al. (2008) zum Ausdruck, dass die von der Kritischen Gerontologie – ob auf politisch-ökonomischer oder ideologiekritischer Basis – thematisierten Probleme real existieren und die Anwendung der kritischen Theorie auf diese Probleme voraussetze, »dass man von der kritischen Analyse an sich zu ihrer Anwendung im realen Leben übergeht« (Dannefer et al., 2008, S. 104).
Читать дальше
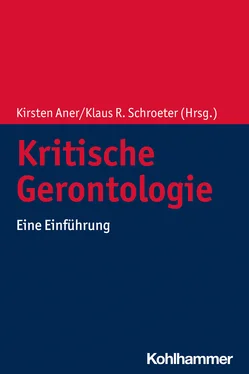
 Kap. 2). Sie kommt zugespitzt in der Position von Dannefer et al. (2008) zum Ausdruck, dass die von der Kritischen Gerontologie – ob auf politisch-ökonomischer oder ideologiekritischer Basis – thematisierten Probleme real existieren und die Anwendung der kritischen Theorie auf diese Probleme voraussetze, »dass man von der kritischen Analyse an sich zu ihrer Anwendung im realen Leben übergeht« (Dannefer et al., 2008, S. 104).
Kap. 2). Sie kommt zugespitzt in der Position von Dannefer et al. (2008) zum Ausdruck, dass die von der Kritischen Gerontologie – ob auf politisch-ökonomischer oder ideologiekritischer Basis – thematisierten Probleme real existieren und die Anwendung der kritischen Theorie auf diese Probleme voraussetze, »dass man von der kritischen Analyse an sich zu ihrer Anwendung im realen Leben übergeht« (Dannefer et al., 2008, S. 104).