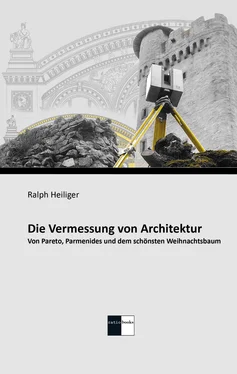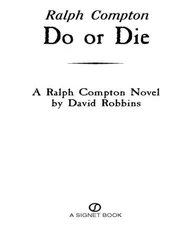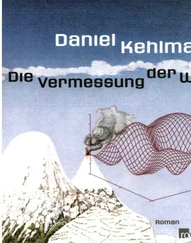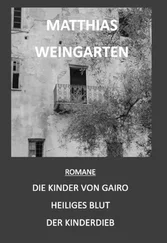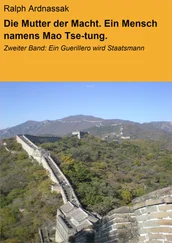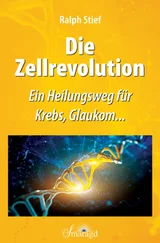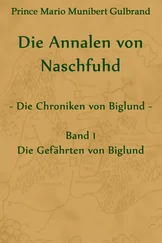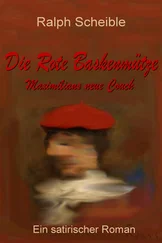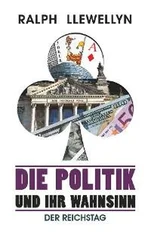Ein Entwurf verläuft in verschiedenen Phasen. Zu Beginn werden Ideen gesammelt. Sie werden weiterentwickelt, geändert und mit neuen Ideen verknüpft. Verschiedene Entwurfsvarianten entstehen und werden verworfen. Sie sind bewusst vorläufig, nicht perfekt ausgearbeitet. Es ist die Phase der Handskizze. Die Handskizze kann spontan entstehen, ohne großes Equipment. Sie fördert das Herantasten, drückt den vorläufigen Charakter der Varianten aus. Form, Gestalt und Funktion bleiben in dieser Phase ungenau. Sie lassen Spielraum zur Interpretation. In seiner persönlichen Handschrift bringt der Architekt seine Gedanken zu Papier. Indem er die Linien mehrfach überzeichnet, findet er schließlich die gewünschte Kontur.76
Kreatives Entwerfen braucht Freiraum. Was sollen uns da exakte Daten bringen? Maßlich-geometrisch und inhaltlich exakte Grundlagen – für was? Für ein schnörkeliges, benebeltes Skizzieren? Sind exakte Daten nicht eher hinderlich als förderlich? Binden sie nicht den Architekten, der nicht allein Ingenieur, sondern zugleich Künstler ist? Bindungen sind doch jedem Künstler fremd?
Zuviel Wissen schränkt die Phantasie des Architekten ein. So schränken die DIN-Normen die Kreativität ebenso ein77 wie die Arbeit am Baudenkmal naturgemäß die schöpferische Kraft des Architekten bremst.78 Im Entwurfsstadium ist die Unschärfe groß. Exakte Daten stehen der Kreativität des Entwurfsprozesses entgegen.79 Exakte Bestandsdaten setzen Bindungen, die zum Zeitpunkt des kreativen Schaffens kontraproduktiv sind.
„Wie entwirft ein Architekt?“, fragt der Architekt Stephan Braunfels und erklärt: „Jeder hat seine eigene Technik. In den ersten Gesprächen mit dem Bauherrn werden die Rahmenbedingungen besprochen. Ein Modell entsteht im Kopf, eine Grundfigur, die immer wieder verändert wird. In vielen Schichten lege ich Skizzenpapier über den Lageplan und lote die Möglichkeiten der ersten Idee nach allen Richtungen aus.“80 Warum spricht Braunfels von „Rahmenbedingungen“ und „Möglichkeiten“? Weil sie selbstverständlich sind. Kreativität entsteht in Begrenztheit. Immer! Der Physiker und Nobelpreisträger Gerd Binning erklärt, man könne nicht kreativ sein, wenn man nicht zugleich begrenzt sei.81
Architekten sind in ihrem Entwurf nie frei! Ihre Kreativität entsteht stets in Abhängigkeit der Rahmensituation. Da ist der Bauherr mit seinen Wünschen und Vorstellungen, da ist das Planungsrecht, der Bebauungsplan, die Statik, der Brandschutz und die Energieeinsparverordnung und auch der Denkmalschutz mit seinen Bindungsplänen. Darin besteht gerade die Kunst des Architekten: in der Begrenztheit eine optimale Lösung zu schaffen. Das Bauen im Bestand definiert eine der größten Begrenztheiten.
Genügt dann nicht für den Entwurf ein einfaches Architektenaufmaß? Einige wenige wichtige Maße bilden eine ausreichende Basis für den Entwurfsprozess. Wofür dann noch ein weiteres, exaktes Aufmaß?
Planen und Entwerfen werden im täglichen Sprachgebrauch oft nicht klar unterschieden. Entwürfe stellen konzeptionelle und gestalterische Ideen dar. Sie sind Ausdrucksmittel, die das Konzept prägnant und ästhetisch vermitteln. Sie sollen Bauherren, Investoren oder Jurys bei Wettbewerben überzeugen. Ihre zeichnerische Darstellung unterliegt keinen speziellen Regeln, sie sind realistisch, können aber auch künstlerisch-abstrakt gehalten sein. Demgegenüber enthalten Planungen die Anweisungen zur Bauausführung. Sie sind spezielle zeichnerische Darstellungen von Bauplanungen.82 Wir sind bei der Umsetzung der kreativen Lösung angelangt: Aus der künstlerischen Darstellung wird die Konstruktionszeichnung, aus dem Entwurf die Planung.
Das Bauaufmaß ist nicht die Grundlage des kreativen Entwerfens. Das Bauaufmaß ist die Grundlage des Planens. Der Baubestandsplan ermöglicht die passgenaue Ausarbeitung des Entwurfs und gewährleistet die passgenaue Umsetzung der Planung in den Bestand. Das ist der Zweck eines Bauaufmaßes: Planen auf maßlich-geometrisch verlässlicher Basis, Simulieren von Planungsvarianten mit Realitätsbezug in der Gewissheit, dass die Planung in die Realität übertragbar ist.
Stimmige Pläne bringen Gewissheit. Mit der Gewissheit in der Planung folgen Terminsicherheit, Kostenstabilität in der Ausführungsphase, Imagegewinn für den Bauherrn. Überraschungen auf der Baustelle werden auf ein Minimum reduziert, mitunter auch ganz vermieden. Je besser die Planungsgrundlagen, desto besser die Planung. Gute Grundlagen ermöglichen gutes Planen.
Wollen Architekten denn auch gut planen können? Können sie wollen?
2.02 Wollen Architekten gut planen können? Können sie wollen?
Wollen Architekten gut planen können? Natürlich wollen sie gut planen können! Was für eine Frage? Jeder Architekt erzürnt zu Recht wegen dieser Frage. Gott sei Dank, sollte man hinzufügen. Und doch ist das mit dem Wollen so eine Sache. Schopenhauer erklärte einst, dass der Wille der Herr sei, und der Verstand sei sein Knecht. Von den eigentlichen Entscheidungen und geheimen Beschlüssen des Willens bleibt der Verstand ausgeschlossen, er hat keine Ahnung von dem, was längst ohne ihn abläuft.83 Architekten wollen gute Architektur, guten Städtebau. Doch Bauherren wollen vor allem eine gute Rendite. Architekt Günther Behnisch: „[…] und wenn gebaut wird, dann sind das meist nur noch Renditeobjekte. So sehen die Gebäude dann eben auch aus. Die Architektur kann nicht in Ordnung bringen, was die Realität versaut.“84 Architekt Meinhard von Gerkan: „Bei dem, was sich moderner Städtebau nennt, klaffen Anspruch und Wirklichkeit fast immer auseinander. Im Regelfall regiert das Kapital, und das setzt nur auf Rendite.“85
Rendite ist das Verhältnis von Gewinn zu Kosten. Für einen höheren Gewinn müssen die Kosten runter. Wie war das beim eigenen Hausbau? Hatte nicht der weit entfernte Bauunternehmer günstiger angeboten als der regional ansässige? Was war mit dem Gerüstbauer? Lagen da nicht mehrere Tausend Euro zwischen dem günstigsten und dem zweitgünstigsten Angebot? War nicht der Fliesenleger aus dem Osten wesentlich billiger als die Firma am Ort? Fenster, Türen, Heizung, Klima, Lüftung? Und die Architektur? Man will nicht zu viel Geld ausgeben. an will nicht zu viel zahlen. Das ist verständlich. Deshalb untermauert der Verstand die Entscheidung, die der Wille schon längst getroffen hat.
Der Wille unterliegt ständig äußeren Einflüssen. Mal sind es politische, mal gesellschaftliche, sehr oft Kostengesichtspunkte. Kosten steuern vor allem das Handeln. Das führt dazu, dass nicht nur für die Berufsgruppe der Architekten das gilt, was Stephan Braunfels schreibt: „Die EU-weite Öffnung des Arbeitsmarktes für Architekten und die Lockerung der Honorarbestimmungen hat dazu geführt, daß wir Architekten innerhalb der EU weniger in einem Qualitätswettbewerb und immer mehr in einem Preiswettbewerb stehen.“86 Widerspricht dieses kostenlastige Denken nicht dem Gedanken der Nachhaltigkeit? Planen ist eine Daueraufgabe. Sie endet nicht mit Fertigstellung des Neubaus. Im Gegenteil werden Gebäude im Laufe ihres Bestandes fortwährend umgebaut, erweitert, angepasst. Besonders die Denkmalpflege dient den Zielen der Nachhaltigkeit87, was nichts anderes bedeutet, als dass es um den dauerhaften Erhalt des Denkmals geht.
Nachhaltig gutes Planen im Bestand beginnt mit aktuellen Bestandsdaten, das heißt mit dauerhaft gepflegten Bestandsdaten. Das kostet Geld. Bestandsdaten erstmalig erfassen, kostet viel Geld! Allerdings kann man die Kosten der Ersterfassung auch als Gegenwert für unterlassene Bestandsdatenpflege sehen. Hätte man aktuelle Bestandspläne des Altbaus, brauchte man sich über eine Bestandsaufnahme keine Gedanken zu machen. Da dies nur in seltenen Fällen zutrifft, steht zuerst einmal ein grundlegendes Bauaufmaß an. Nun könnte man meinen, dass wenigstens ab diesem Moment die Nachhaltigkeit beginnt. Doch weit gefehlt!
Читать дальше