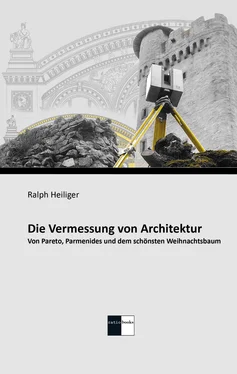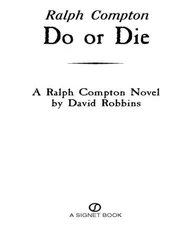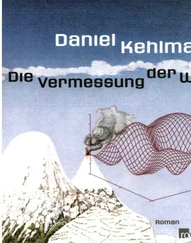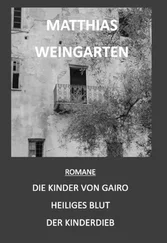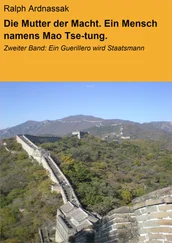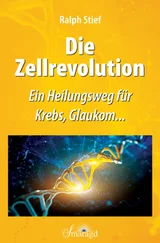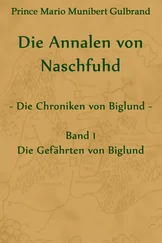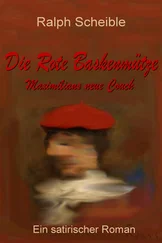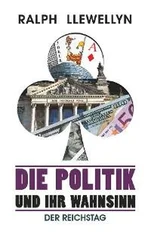Stefan Breitling erklärt, es sei unbestritten, dass die angewandte Bauforschung der Denkmalpflege wertvolle Dienste leistet als sanierungsvorbereitende Untersuchung. Sie habe den Planern dringend benötigte Informationen über Bauzeiten, Denkmalwert, Konstruktionszusammenhänge und Schadensalter zur Verfügung gestellt.52 Schuller erklärt, die Denkmalpflege sei zu einem der wichtigsten Aufgabengebiete der Bauforschung geworden.53 Dies habe eine lange Tradition, die bis ins 16. Jahrhundert zurückzuverfolgen sei. Die heute gültige Systematisierung und Weiterentwicklung der klassischen Methoden der Bauforschung für Zwecke der Denkmalpflege sei Gert Mader vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu verdanken. Nach Barbara Lanz und Sonja Mitterer, beide Architekten, umfasst die Bauforschung sowohl die wissenschaftliche Erforschung des Bauwerks als auch die alltäglichen Probleme des Architekten. Bauforschung gehöre sozusagen zum Planungsprozess des Architekten.54
Angewandte Bauforschung? Forschen im Dienste der Wirtschaft, des Marktes? Ist das denn Forschen? Vielleicht fällt es nicht gleich auf, aber Forschen ist das nicht, was die angewandte Bauforschung da macht. Angewandte oder anwendungsorientierte Forschung, so schreibt schon der Physiker und Autor Hans Graßmann, sei Unfug. Wer den Beweis brauche, möge bitte erklären, was denn eine „nicht anwendungsorientierte Forschung“ sei, denn wenn es das eine gibt, dann gibt es auch das andere. Das andere gibt es aber nicht. Welchen Sinn sollte auch eine Forschung haben, die auf die Nichtanwendung orientiert ist? Forschen bedeutet, Antworten zu finden auf etwas, von dem man nichts weiß. Deshalb forscht man.55
Die angewandte Bauforschung ist technisch orientiert. Sie entwickelt Lösungen zu einer bautechnischen Aufgabe. Forschung kann man nicht planen; die Entwicklung schon. Sicher hängen Forschung und Entwicklung eng zusammen, aber das bedeutet nicht, sie seien das gleiche. Auch Hand und Arm hängen eng zusammen, aber einen Arzt, der behauptet, sie seien identisch, würde ich meiden.56 Großmann sagt es sehr deutlich: Die angewandte Bauforschung ist lediglich „methodischer Bestandteil der kunstgeschichtlichen Architekturforschung“.57 Sie forscht nicht im wissenschaftlichen Sinne. Es ist vielmehr eine Bestandsaufnahme, eine Befunderhebung, eine Zustandsfeststellung, eine Dokumentation, schlicht: eine Erfassungsmethode.
Enttäuscht stellt der Professor für Bauforschung und Baugeschichte, Stefan Breitling, fest, dass Bauforscher manchmal kaum in der Lage sind, ihre Erkenntnisse über eine bloße Beschreibung der Befunde hinaus zu formulieren. Die Bauforschung beschränke sich zu oft auf eine bloße Auflistung von Befunden und Datierungen.58 Das können in der Tat auch Nichtforscher, also Betriebe der freien Wirtschaft, mithin private „Bauforscher“. Denn der Zweck ihrer Arbeit bedeutet einen Nutzen für ihren Auftraggeber. Damit hat ihre Arbeit einen monetären Wert. Demzufolge ist angewandte Bauforschung nichts anderes als ein Geschäftsmodell, selbst wenn sie wissenschaftliche Methoden anwendet.
Hädler erinnert daran, dass die Disziplin der Historischen Bauforschung als Hilfswissenschaft der Denkmalpflege in verschiedenen Publikationen der letzten Jahre ausgiebig dargestellt worden ist. „Als freiberufliche Perspektive auch für Architekten entwickelte sie sich von Bayern ausgehend Anfang der 80er Jahre.“59 Also ein Geschäftsmodell, keine Forschung.
Demgegenüber ist die Historische Bauforschung, also die Wissenschaft Bauforschung, Teil der kunsthistorischen Forschung. Ihre Forschung orientiert sich an der wissenschaftlichen Frage. Großmann weiter: „Lange Zeit wurde das Aufmaß als Inbegriff der [Historischen] Bauforschung angesehen, was teilweise zu einer einseitigen, vornehmlich technischen Sehweise der Baugeschichte geführt hat. Keinesfalls erschöpft sich Bauforschung im Aufmaß.“60 Das Bauaufmaß mag Teil des Forschungsprozesses sein, zwingend ist es nicht. Bei den Forschungen 1999 bis 2003 an der größten Kreuzfahrerburg, dem Crac des Chevaliers in Syrien, war noch nicht einmal ein Aufmaß nötig, wie Großmann berichtet: „Die Fragestellung, die dieser Forschungsarbeit zugrunde lag, richtete sich auf eine Überprüfung und Konkretisierung der Datierung der einzelnen Bauteile sowie eine Untersuchung der Baufunktionen, […]“61 Baugeschichtliche Erkenntnis ist also auch ohne ein Aufmaß möglich.
Im Gegensatz zur wissenschaftlichen Bauforschung benötigt das Bauen im Bestand unbedingt verlässliche Planungsgrundlagen. Das Bauaufmaß liefert sie in Zeichnungen, Beschreibungen und Fotos. Es kann zugleich eine Basis sein für die Denkmalpflege. Die Denkmalpflege erweitert diese Basis hinsichtlich des Erhaltens und Bewahrens materieller Geschichtsquellen. Für die Historische Bauforschung kann es die Beantwortung der wissenschaftlichen Frage stützen, muss es aber nicht. Die bautechnische Untersuchung eines stehenden Bauwerks zur Vorbereitung einer Baumaßnahme ist keine Wissenschaft. Lanz/Mitterer nennen zwei grundsätzlich verschiedene Fächer, wenn sie sagen, dass die Bauforschung sowohl die wissenschaftliche Erforschung des Bauwerks umfasst als auch die alltäglichen Probleme des Architekten einbindet, dass Bauforschung sozusagen zum Planungsprozess des Architekten gehört.62 Da hilft auch nicht das Argument, dass die Ergebnisse der Bauforschung die Kosten bei Umbauten oder Restaurierungen mindern helfen. Günter Eckstein macht es besser: Er vermeidet den Begriff Bauforschung und erklärt, dass das Bauaufmaß als Leistung zu verstehen ist, um exakte Pläne für Ausschreibung, Kalkulation, Bauausführung, Abrechnung und Schlussdokumentation zu erhalten.63 Das ist zweckorientiert. Das ist ein Geschäftsmodell. Hädler macht schließlich einen Deckel drauf, indem er dem Bestandsaufmaß als „Besondere Leistung“ gemäß der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ein Honorar zuordnet.64
In der Denkmalpflege war man lange Zeit der Meinung, dass die personelle Besetzung des Amtes nicht ausreichte, die Fülle der Aufgaben zu bewältigen.65 Dass man für das Bauaufmaß Hochschulen bemühte, dass man in der Bauforschung glaubte, zu wenig Personal zu haben, um alle Bauten wissenschaftlich zu untersuchen, lässt vermuten, dass man dem Bauaufmaß einen Markt nicht zusprach. Nun hat sich dieser Markt entwickelt. Das Bauaufmaß kann in der Tat als Antwort auf den Marktbedarf verstanden werden. Seine Ergebnisse können der Wissenschaft Bauforschung dienen, vor allem genügen sie dem Planen im Bestand und können in verdichtender Weise die Denkmalpflege stützen.
Aus einem so verstandenen Bauaufmaß lassen sich immer die maßlich-geometrischen Anforderungen an ein Verwalten und Bewirtschaften von Gebäuden und seinen technischen Einrichtungen erfüllen, dem sogenannten Facility-Management. Umgekehrt geht das nicht: Das direkt auf die Zwecke des Facility-Managements ausgerichtete Aufmaß gleicht eher einer Pareto-Aufnahme: zwanzig Prozent Messwerte ergeben achtzig Prozent Architektur.66 Bestandsdaten für Facility-Management zielen nicht auf die Konstruktion und Statik, sie haben einen anderen Qualitätsanspruch.67 Generell gilt bei der Datenerfassung für Facility-Management: Weniger ist manchmal mehr! Die Festlegung, wie viele Informationen über Gebäude und Anlagen gebraucht werden, ist eine Entscheidung der Führungsebene.68 Damit ist auch klar, dass es hier nicht mehr ums Bauen geht, sondern die Leistung betriebswirtschaftlich begründet ist. Deutlicher als die Stadt Witten kann man es nicht erklären; in ihrer Leistungsbeschreibung zur Aufnahme ihrer städtischen Immobilien heißt es: Die „Wandstärke wird aus der Zeichnung ermittelt und ist ein fiktiver Wert, der sich nicht aus einer Messung, sondern aus der angenäherten Verteilung der NGF [Nettogrundfläche] über die BGF [Bruttogrundfläche] ergibt.“Pareto lässt grüßen!69
Читать дальше