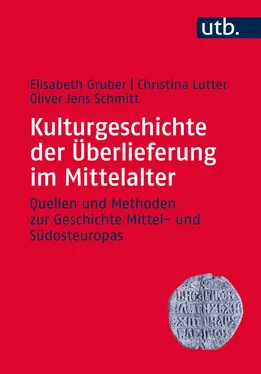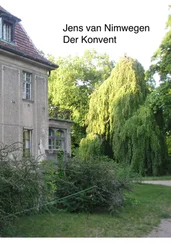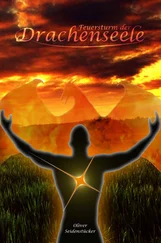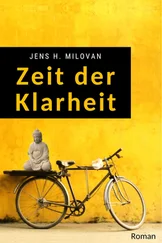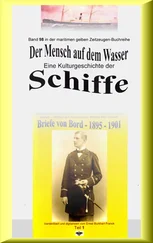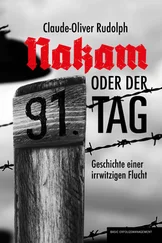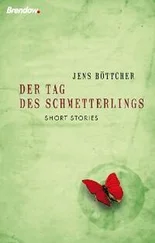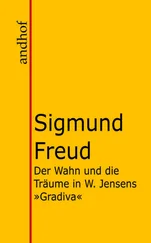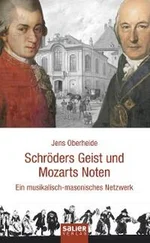1. Spalte: im Text/in den Karten am häufigsten verwendete Form
2. Spalte: heute amtliche Bezeichnung
3. Spalte: weitere wichtige Namensvarianten
Abkürzungen:
al. = albanisch; bg. = bulgarisch; bks. = bosnisch/kroatisch/serbisch; gr. = griechisch; it. = italienisch; lat. = lateinisch; lit. = litauisch; maz. = mazedonisch; pol. = polnisch; rum. = rumänisch; slowa. = slowakisch; slowe. = slowenisch; tsch. = tschechisch; tr. = türkisch; ung. = ungarisch; ukr. ukrainisch
| Adrianopel |
tr. Edirne |
gr. Adrianupolis, bg. Odrin |
| Agram |
bks. Zagreb |
|
| Alessio |
al. Lezha |
lat. Lissus, bks. Lješ |
| Antivari |
bks. Bar |
al. Tivar |
| Belgrad |
bks. Beograd |
dt. Griechisch-Weißenburg, ung. Nándorfehérvár |
| Breslau |
pol. Wrocław |
|
| Brigetio |
ung. Komárom |
dt. Komorn |
| Brünn |
tsch. Brno |
|
| Budweis |
tsch. České Budějovice |
|
| Capodistria |
slowe. Koper |
|
| Cilli |
slowe. Celje |
lat. Celeia |
| Czernowitz |
ukr. Černivci |
rum. Cernǎuţi [<<13] |
| Dubrovnik |
bks. Dubrovnik |
it. Ragusa, gr. Rausion |
| Dulcigno |
bks. Ulcinj |
al. Ulqin |
| Durostorum |
bg. Silistra |
|
| Dyrrachion |
al. Durrës |
bks. Drač |
| Erlau |
ung. Eger |
slowa. Jáger |
| Fünfkirchen |
ung. Pécs |
bks. Pečuh |
| Gran |
ung. Esztergom |
lat. Strigonium |
| Hermannstadt |
rum. Sibiu |
ung. Nagyszeben |
| Iglau |
tsch. Jihlava |
|
| Kalocsa |
ung. Kalocsa |
dt. Kollotschau |
| Kaschau |
slowa. Košice |
ung. Kassa |
| Klausenburg |
rum. Cluj |
ung. Kolozsvár |
| Königgrätz |
tsch. Hradec Králové |
|
| Korčula |
bks. Korčula |
it. Curzola |
| Kotor |
bks. Kotor |
lat./gr. Dekatera, it. Cattaro |
| Krakau |
poln. Kraków |
|
| Kremnitz |
slowa. Kremnica |
ung. Körmöcbánya |
| Krk |
bks. Krk |
it. Veglia |
| Kronstadt |
rum. Braşov |
ung. Brassó |
| Krumau |
tsch. Český Krumlov |
|
| Kuttenberg |
tsch. Kutná Hora |
|
| Laibach |
slow. Ljubljana |
it. Lubiana, lat. Emona |
| Lemberg |
ukr. Lviv |
|
| Leutschau |
slowa. Levoča |
ung. Lőcse |
| Marburg |
slowe. Maribor |
|
| Neusohl |
slowa. Banská Bystrica |
ung. Besztercebánya |
| Nikaia |
tr. Iznik |
|
| Niš |
bks. Niš |
lat. Naissus |
| Ochrid |
bks. Ohrid |
al. Ohër |
| Ödenburg |
ung. Sopron |
lat. Scarabantia |
| Ofen |
ung. Budapest |
ung. Buda, bks. Budim |
| Olmütz |
tsch. Olomouc |
|
| Pettau |
slowe. Ptuj |
[<<14] |
| Pirano |
slowe. Piran |
|
| Prag |
tsch. Praha |
|
| Pressburg |
slowa. Bratislava |
ung. Pozsony, slowa. Prešporok (bis 1919) |
| Raab |
ung. Győr |
slowa. Ráb |
| Rab |
bks. Rab |
ital. Arbe |
| Schäßburg |
ung. Segesvár |
rum. Sigişoara |
| Schemnitz |
slowa. Banská Štiavnica |
ung. Selmecbánya |
| Šibenik |
bks. Šibenik |
it. Sebenico |
| Sillein |
slowa. Žilina |
ung. Zsolna |
| Sirmium |
bks. Sr[ij]emska Mitrovica |
ung. Szávaszentdemeter |
| Skopje |
maz. Skopje |
al. Shkupi, bks. Skoplje, tr. Üsküb |
| Skutari |
al. Shkodra |
bks. Skadar, lat. Scodra |
| Solin |
bks. Solin |
it./lat. Salona |
| Split |
bks. Split |
it. Spalato |
| Stuhlweißenburg |
ung. Székesfehérvár |
bks. Stolni Biograd |
| Teschen |
tsch. Český Těšín |
|
| Thessalonike |
gr. Thessaloniki |
tr. Selanik, bg. Solun |
| Triest |
it. Trieste |
slowe. Trst |
| Trogir |
bks. Trogir |
it. Traù |
| Troppau |
tsch. Opava |
|
| Tyrnau |
slowa. Trnava |
ung. Nagyszombat |
| Wardein/Großwardein |
ung. Nagyvárad |
rum. Oradea |
| Wilna |
lit. Vilnius |
|
| Zara |
bks. Zadar |
lat. Iadera |
| Zengg |
bks. Senj |
it. Segna |
| Znaim |
tsch. Znojmo |
[<<15] |
Einleitung – eine Annäherung
Mehr als 25 Jahre sind seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und dem dadurch eingeleiteten Ende der Teilung Europas in einen Westen und einen Osten vergangen. In diesen bald drei Jahrzehnten hat sich die politische ebenso wie die akademische Landschaft des Kontinents maßgeblich verändert, und dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. In demselben Maß, in dem „alte“ Grenzen an Bedeutung verloren haben, hat das Bewusstsein für Formen aktueller, etwa wirtschaftlich begründeter, aber ebenso historisch gewachsener regionaler Zusammengehörigkeit zugenommen, die quer zu alten und neuen nationalen Grenzen liegen. Gleichzeitig haben sich aber auch neue Brüche und Abgrenzungen aufgetan. Die Dynamik und Heterogenität der politischen, sozioökonomischen und kulturellen Entwicklung innerhalb Europas spiegelt sich in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, und zwar sowohl in den einzelnen Ländern als auch in vergleichender Perspektive. Dieser Befund gilt grundsätzlich auch für die Mediävistik einschließlich aktueller einschlägiger Überblickswerke, allerdings mit der interessanten Leerstelle, dass deutsch- und auch englischsprachige Handbücher zur Überlieferung des europäischen Mittelalters zu einem überwiegenden Teil auf den geographischen Raum des Heiligen Römischen Reichs bzw. den „Westen“ Europas und Italien fokussieren und vergleichsweise selten Beispiele aus der Überlieferung „Mittel- und Südosteuropas“ geben.
Überlieferungschancen und Überlieferungszufälle
Maßgebliche Motivation einer deutschsprachigen Überlieferungsgeschichte dieses Raumes ist daher einmal, durch einen Perspektivenwechsel bislang wenig berücksichtigte, aber wesentliche Grundlagen einer vergleichenden europäischen Geschichte zu vermitteln und gleichzeitig anhand der Vielfalt und Heterogenität der Überlieferungslagen die historische Besonderheit unterschiedlicher Regionen Europas ebenso wie ihre komplexen Bezüge zueinander sichtbar zu machen. Wir wollen anhand konkreter Beispiele einen Einblick in die Entstehungsbedingungen historischer Überlieferung und in deren soziokulturelle und politische Hintergründe geben und dabei auch [<<16] Seitenzahl der gedruckten Ausgabe einen Blick auf die Traditionen der Forschung ermöglichen, durch deren Fragen jede Quelle erst zum „Sprechen“ gebracht wird:
Überlieferung, so formulierte Arnold Esch 1985 unter dem programmatischen Titel „Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem des Historikers“, ist das, was der Historiker in Händen hält: was ihm über frühere Zeiten, was ihm aus früheren Zeiten überliefert ist. Der Historiker weiß, daß sein Wissen Stückwerk ist – aber welche Stücke er in Händen hält, das wird ihm nicht ebenso deutlich […].
Читать дальше