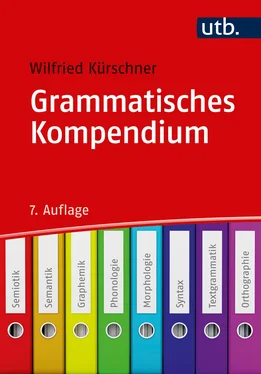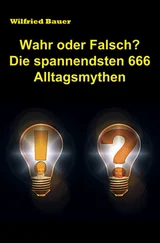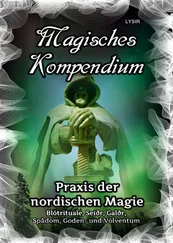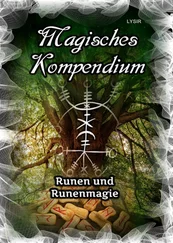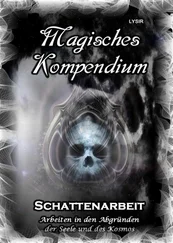//Z// = /z/ und /s/ (z. B. {Eis}: AllomorphAllomorphe /aíez/ (eis-ig) , /aíes/ (Eis) , morphophonemisch: //aíeZ//).
Zur AuslautverhärtungAuslautverhärtung in der deutschen Sprachgeschichte ▶ Nr. 4.3/4. – Zur Auslautverhärtung in der OrthographieOrthographie ▶ Abschnitt 9.3.1.2.
5.2/5 UmlautUmlaut
Morphophonemischer WechselWechselmorphophonemischermorphophonemischer Wechsel:
| /a/ |
— |
/E/ |
| /a</</td> |
— |
/E</</td> |
| // |
— |
/¿/ |
| /o</</td> |
— |
/O</</td> |
| /U/ |
— |
/Y/ |
| /u</</td> |
— |
/y</</td> |
| /aío/ |
— |
/íO/; |
auch: Erscheinen des jeweils zweitgenannten PhonemPhonems in AllomorphAllomorphen eines MorphemMorphems.
Beispiel:
Das Morphem {Hut} hat zwei AllomorphAllomorphe: /huNr. 5.2/2). Ihr VorkommenVorkommen richtet sich nach der morphologischen UmgebungUmgebung: Vor den MorphemMorphemen {PluralPlural} und {DiminutivumDiminutivum} erscheint /hy</, sonst /hu</. Wenn man /u</ und /y</ als MorphophonemMorphophonem //U<// zusammenfasst, ergibt sich in morphophonemischer Schreibweise: //hU
Das in der Zusammenstellung oben jeweils an zweiter Stelle genannte Glied eines Paares wird selbst auch UmlautUmlaut genannt. Die jeweils an erster Stelle genannten VokalVokale sind umlautfähig umlautfähige VokaleVokalumlautfähig. Der Vorgang des Wechsels vom BasisvokalVokalBasis-Basisvokal zu seinem Umlaut wird auch UmlautungUmlautung genannt.
Umlaut tritt auch in der 2. und 3.Pers. Sg. Präs. Ind. Akt. einiger starkerVerbstarkesstarkVerb Verben auf, z. B. rätst, rät (zu rat(en) ), lädst, lädt (zu lad(en) ), ▶ Nr. 6.2/16.
Zum UmlautUmlaut in der deutschen Sprachgeschichte ▶ Nr. 4.3/1 und 4.3/2. Zur UmlautungUmlautung bei /E/ und /íO/ in der OrthographieOrthographie ▶ Abschnitt 9.3.1.2.
5.2/6 e / i -WechselWechsele/i-- (= »BrechungBrechung« = »HebungHebunge/i-Wechsel«)
Morphophonemischer WechselWechselmorphophonemischermorphophonemischer Wechsel:
| /E/ |
— |
/I/ |
| /e</</td> |
— |
/I/ |
| /e</</td> |
— |
/i</</td> |
| /E</</td> |
— |
/i</. |
e / i -Wechsele/i-Wechsel (gelegentlich auch »BrechungBrechung« oder »HebungHebung« genannt) tritt bei der Bildung von Formen einiger starkenstarkVerb Verben auf, und zwar erscheinen AllomorphAllomorphe mit /I/ bzw. /i</ in der 2. und 3.Pers.Person Sg. Präs.Präsens Ind.Indikativ Akt.Aktiv und im ImperativImperativ SingularSingular; AllomorphAllomorphe mit /E, e<, E</ erscheinen im InfinitivInfinitiv und weiteren Formen solcher VerbVerben (▶ Nr. 6.2/16). Beispiele: helfen – hilfst (/E/ – /I/), treten – tritt (/e</ – /I/), geben – gib (/e</ – /i</), gebären – gebierst (/E</ – /i</).
5.2/7 AblautAblaut
Morphophonemischer WechselWechselmorphophonemischermorphophonemischer Wechsel zwischen VokalVokalen, besonders bei AllomorphAllomorphen von starkVerb(starken) VerbVerben.
Beispiel:
In AllomorphAllomorphen des VerbVerbmorphems {sing(en)} stehen die VokalVokale /I/, /a/ und /U/ zueinander im Verhältnis des AblautAblauts. Die drei durch AblautAblaut der VokalVokale miteinander verbundenen AllomorphAllomorphe sind: /zIN/, /zaN/, /zUN/ ().
VerbVerben, deren AllomorphAllomorphe durch AblautAblaut miteinander verbunden sind, heißen starkVerbstarkVerb starke VerbVerbVerbstarkes en. Sie unterscheiden sich von den schwachVerb schwachen VerbVerbVerbschwachesschwachVerb enauch dadurch, dass sie ihre PräteritumPräteritalformen = Imperfektformen und ihre Partizip PerfektPartizip-Perfekt-Formen = Partizip-IIPartizip II-Formen nicht mit t bilden: (wir) sang-en, ge-sung-en im Gegensatz zu (wir) lach-t-en, ge-lach-t (▶ Nr. 6.2/16).
Morpheme lassen sich unter mehreren Gesichtspunkten in unterschiedliche Typen differenzieren und klassifizieren: Hinsichtlich ihrer Bedeutungsfunktion wird zwischen lexikalischenund grammatischen MorphemMorphem en(▶ Nr. 5.3/1, Nr. 5.3/2) unterschieden; hinsichtlich ihres VorkommenVorkommens bzw. ihrer Selbstständigkeit unterscheidet man zwischen freies MorphemMorphemMorphemfreies freienund gebundenes Morphem gebundenen MorphemMorphemgebundenesMorphem en(▶ Nr. 5.3/3, Nr. 5.3/4) mit dem Spezialfall der unikales Morphem unikalenMorphemunikales bzw. blockiertMorphemblockiertesblockiertes Morphem en MorphemMorphem e(▶ Nr. 5.3/5, Nr. 5.3/6) und der Konfix Konfixe(▶ Nr. 5.3/6a). Spezialfälle in anderer Hinsicht bilden diskontinuierliches Morphem diskontinuierliche MorphemMorphemdiskontinuierlichesMorphem e(▶ Nr. 5.3/7) und Portmanteau-MorphemMorphemPortmanteau-- Portmanteau-AllomorphAllomorphPortmanteauAllomorph e(▶ Nr. 5.3/8).
Nach der Bedeutung/Funktion:
5.3/1 Lexikalisches Morphemlexikalisches MorphemMorphemlexikalisches
MorphemMorphem mit eigener lexikalischer oder SachbedeutungBedeutung. Kombinationen von lexikalisches Morphemlexikalischen MorphemMorphemen ergeben (neue) Wörter bzw. WortstammWortstämmStammStammWort-e (▶ Nr. 5.4/1).
5.3/2 Grammatisches MorphemMorphemgrammatischesgrammatisches Morphem
MorphemMorphem mit grammatischer oder struktureller BedeutungBedeutung. Kombinationen von lexikalisches Morphemlexikalischen MorphemMorphemen mit grammatisches Morphemgrammatischen MorphemMorphemen ergeben WortformWortformen, nicht neue Wörter.
Nach dem Vorkommen/der Selbstständigkeit:
5.3/3 Freies MorphemMorphemfreiesfreies Morphem
MorphemMorphem, dessen AllomorphAllomorph(e) allein für sich (ohne direkte Bindung an ein anderes MorphemMorphem) in einem Satz als Wort auftreten kann (können).
5.3/4 Gebundenes MorphemMorphemgebundenesgebundenes Morphem
MorphemMorphem, dessen AllomorphAllomorph(e) in einem Satz nicht selbstständig als Wort auftreten kann (können), sondern immer an ein anderes MorphemMorphem gebunden ist (sind).
Beispiel zu Nr. 5.3/1 bis Nr. 5.3/4:
In dem folgenden Satz sind die MorphemMorphemtypen der AllomorphAllomorphe gekennzeichnet:
Auf lex,fr d gr,geb -em gr,geb Schreib lex,fr- tisch lex,fr lieg lex,fr- t gr,geb
Читать дальше