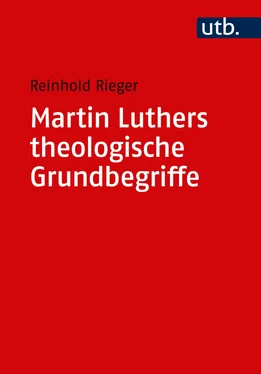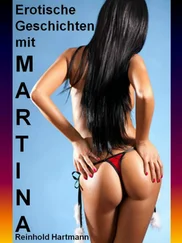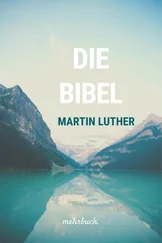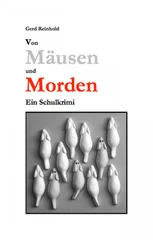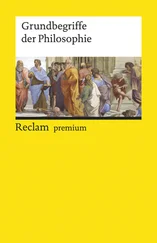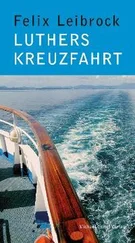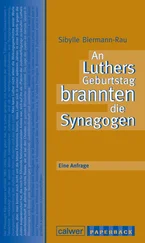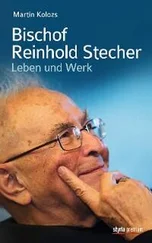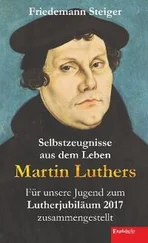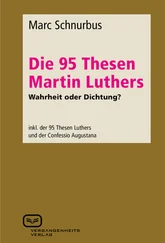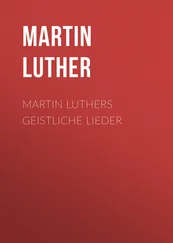Reinhold Rieger - Martin Luthers theologische Grundbegriffe
Здесь есть возможность читать онлайн «Reinhold Rieger - Martin Luthers theologische Grundbegriffe» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Martin Luthers theologische Grundbegriffe
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Martin Luthers theologische Grundbegriffe: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Martin Luthers theologische Grundbegriffe»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dieses Lehrbuch bietet eine Auswahl der wichtigsten theologischen Grundbegriffe Luthers, dargeboten anhand von Zitaten, die in der Weimarer Ausgabe nachgewiesen werden.
Es füllt die Lücke zwischen Konkordanzen und systematisierenden Darstellungen der Theologie Luthers und ist für Studierende, aber auch für PfarrerInnen oder ReligionslehrerInnen gedacht.
Martin Luthers theologische Grundbegriffe — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Martin Luthers theologische Grundbegriffe», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
4. Ist nun Christi Fleisch aus allem Fleisch ausgesondert und allein ein geistliches Fleisch vor allen, nicht aus Fleisch, sondern aus Geist geboren, so ist es auch eine geistliche Speise. Ist es eine geistliche Speise, so ist es eine ewige Speise, die nicht vergehen kann. Sein Fleisch ist nicht aus Fleisch noch fleischlich, sondern geistlich, darum kann es nicht verzehrt, verdaut, verwandelt werden, denn es ist unvergänglich wie alles, was aus dem Geist ist. Vergängliche Speise verwandelt sich in den Leib, der sie isst. Diese Speise wiederum verwandelt den, der sie isst, in sich und macht ihn ihr selbst gleich, geistlich, lebendig, ewig (23, 203, 14–29; vgl. 205, 20–23). Luther lehrt, dass Christi Fleisch nicht allein keinen Nutzen, sondern auch Gift und Tod sei, wenn es ohne Glaube und Wort gegessen wird (26, 353, 27–31). Der Evangelist Johannes hätte wohl sagen können: Das Wort ward Mensch, er sagt aber nach der Schrift Brauch: es ward Fleisch, um anzuzeigen die Schwachheit und Sterblichkeit, denn Christus hat menschliche Natur angenommen, die sterblich und dem schrecklichen Zorn und Gericht Gottes wegen der Sünde des menschlichen Geschlechts unterworfen ist, welchen Zorn dieses schwache und sterbliche Fleisch in Christus gefühlt und gelitten hat (46, 632, 21–26).
|76|5. Christus und die Kirche sind ein Fleisch und ein Geist und haben alles gemeinsam. Christus hat die Menschheit angenommen und ist mit der Kirche in einem Fleisch verbunden, was ein großes und freudiges Geheimnis ist, in dem in eins zusammenkommen der Reiche und der Arme, der Gerechte und der Sünder, der Selige und der Verdammte, der Sohn der Gnade und der Sohn des Elends (5, 549, 10–13).
6. Die unvergleichliche Gnade des Glaubens ist es, dass er die Seele verbindet mit Christus wie die Braut mit dem Bräutigam. Durch dieses Geheimnis werden Christus und die Seele ein Fleisch. Wenn sie ein Fleisch sind und zwischen ihnen eine wahrhafte Ehe geschlossen wird, so folgt, dass alles, was ihnen gehört, sowohl das Gute wie auch das Böse, beiden gemeinsam wird, damit, was auch immer Christus besitzt, die gläubige Seele als das Ihre genießen und sich dessen rühmen kann, und was immer die Seele besitzt, sich Christus als das Seine aneignet (7, 54, 31–38).
📖 Oswald Bayer, Das Wort ward Fleisch, in: ders., Hg., Creator est Creatura, 2007, 5–34. Erdmann Schott, Fleisch und Geist nach Luthers Lehre, 2. Aufl. 1969.
[Zum Inhalt]
Form
→ Reformation
Sobald dieses und andere Wörter in der Theologie oder in theologischen Zusammenhängen gelesen werden, denkt der menschliche Geist sofort an die, die in der Naturwissenschaft gebraucht werden, und wird abgelenkt und weggeführt in verwirrende und gefährliche Streitigkeiten. Denn die Naturwissenschaft schmeichelt natürlich der Vernunft, aber die Theologie ist hoch über das menschliche Verstehen gesetzt (39I, 228, 14–229, 5). Beim Wort ‚formal‘ und anderen naturwissenschaftlichen Begriffen bringt die Philosophie immer etwas Schädliches mit sich, wenn sie in die Theologie übertragen werden, deshalb muss sorgfältig beachtet werden, dass die Wörter rein und sicher verstanden werden, nämlich dass sie, wenn sie daher übertragen werden, gleich neu werden (39I, 229, 35–230, 26).
1. Christus ist den Menschen ähnlich, d.h. den Sündern und Schwachen, und er hat keine andere Gestalt noch Form als die des Menschen und Knechts, dass er uns nicht in der Form Gottes verachtete, sondern unsere Form annahm und unsere Sünden in seinem Leib trug (2, 603, 17–20). Obwohl er voll göttlicher Form war und für sich selbst genug hatte, hat er sich dennoch dessen alles entäußert (7, 35, 14–16). Christus verwirft alle hohe Form und trägt des Kreuzes Form (10I.1, 390, 17f.).
2. Paulus sagt, Adam sei die Form Christi, da jener Urheber der Sünde, dieser der Gerechtigkeit sei, aber die Form ist dem Ursprung ähnlich, nicht den ähnlichen Dingen (5, 314, 20–22).
3. Der Papst ist nicht ein Statthalter Christi im Himmel, sondern allein Christi auf Erden wandelnd, denn Christus im Himmel, in der regierenden Form, bedarf keines Statthalters. Aber er darf es sein in der dienenden Form, als Christus auf Erden ging, mit arbeiten, predigen, leiden und sterben. So kehren sie es um, nehmen Christus die himmlische regierende Form und geben sie dem Papst, lassen die dienende Form ganz untergehen (6, 434, 9–15).
|77|4. So muss der Christ, wie sein Haupt Christus durch seinen Glauben erfüllt und gesättigt, zufrieden sein mit dieser durch den Glauben erhaltenen Form Gottes (7, 65, 26f.).
📖 Joachim Mehlhausen, Forma Christianismi, in: ZThK 87 (1990) 447–455.
[Zum Inhalt]
Freiheit
→ Wille
1. Wesen: Freiheit hat theologisch gesehen wie die Knechtschaft entsprechend den zwei Aspekten des Menschen zwei Seiten: Die Freiheit des Geistes oder des neuen Menschen ist die Befreiung vom alten Menschen und von der Knechtschaft der Sünde. Die Freiheit des Fleisches oder des alten Menschen ist im Gegenteil die Loslösung vom neuen Menschen und von der Knechtschaft der Gerechtigkeit. Die Knechtschaft des Geistes ist selbst die Freiheit des Geistes, und die Knechtschaft des Fleisches ist selbst die Freiheit des Fleisches (57II, 99, 14–18). Die Freiheit, zu der uns Christus befreite, befreit nicht aus irgendeiner menschlichen Knechtschaft oder der Gewalt von Tyrannen, sondern vom ewigen Zorn Gottes, nämlich im Gewissen. Denn Christus machte uns nicht politisch, nicht fleischlich frei, sondern theologisch oder geistlich, d.h. damit unser Gewissen frei und freudig sei, nicht den kommenden Zorn fürchte (40II, 3, 20–24). Aus dieser folgt eine andere Freiheit, durch die wir durch Christus sicher und frei gemacht werden vom Gesetz, Sünde, Tod, Macht des Teufels, Hölle usw. (40II, 4, 13f.). Die evangelische Freiheit herrscht nur in dem, was zwischen Gott und dir stattfindet, nicht zwischen dir und deinem Nächsten. Aber diese Freiheit hindert nicht, dass du dich mit deinem Nächsten verbinden kannst, denn dein Nächster befiehlt dir nicht, losgelöst und frei zu sein wie Gott. Sonst erlaubte er auch alle Verträge, Bündnisse und Abmachungen zu halten oder zu brechen nach Belieben (8, 615, 28–616, 1). Ein Christenmensch, der also in der Freiheit steht, darf nichts mehr sorgen, dass er fromm und gerechtfertigt werde, er weiß wohl, dass ihn die Werke weder fromm noch unfromm machen können. So bleibt er immerzu frei, tut, was man von ihm haben will (9, 569, 24–28). Ein christliches Wesen besteht nicht in äußerlichem Wandel, es wandelt auch den Menschen nicht nach dem äußerlichen Stand, sondern nach dem innerlichen, das ist, es gibt ein anderes Herz, einen anderen Mut, Willen und Sinn, welcher eben die Werke tut, die ein anderer ohne solchen Mut und Willen tut (10I.1, 137, 14–22). Unsere christliche Herrschaft, Freiheit und Macht muss man allein geistlich verstehen, denn Christus hat nichts wollen zu schaffen haben mit weltlicher Herrschaft. Das heißt aber geistliche Freiheit, wenn die Gewissen frei bleiben (10II, 15, 24–27). Der Satz von der christlichen Freiheit sagt, dass alle äußerlichen Dinge frei sind vor Gott und ein Christ sie mag gebrauchen, wie er will, er mag sie nehmen oder fahren lassen. Du bist Gott nichts schuldig zu tun, als glauben und bekennen, in allen anderen Sachen gibt er dich los und frei, dass du es machst, wie du willst, ohne alle Gefahr des Gewissens. Bei dem Menschen oder bei deinem Nächsten mache ich dich nicht frei, denn ich will ihm das Seine nicht nehmen, bis er selbst dich auch frei gibt. Bei mir aber bist du frei. Darum so merke und unterscheide diese Freiheit recht, dass |78|es zwischen Gott und dir nicht also steht wie zwischen dir und deinem Nächsten. Dort ist diese Freiheit, hier ist sie nicht. Denn Gott gibt dir diese Freiheit nur in dem, was dein ist, nicht in dem, was deines Nächsten ist (12, 131, 23–132, 10). So bist du aller Dinge frei bei Gott durch den Glauben, aber bei den Menschen bist du jedermanns Diener durch die Liebe (12, 133, 2f.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Martin Luthers theologische Grundbegriffe»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Martin Luthers theologische Grundbegriffe» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Martin Luthers theologische Grundbegriffe» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.