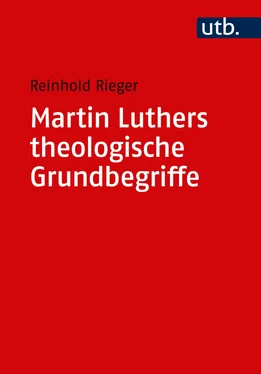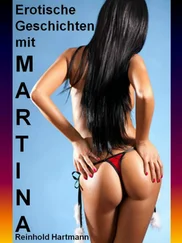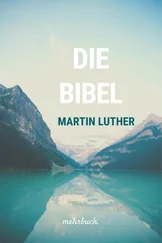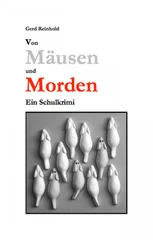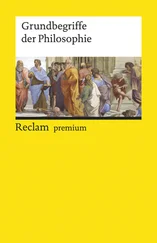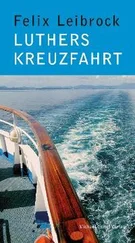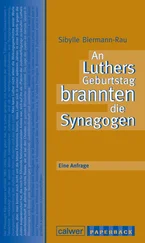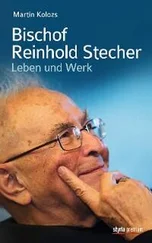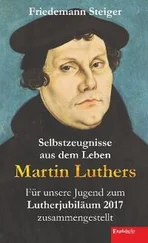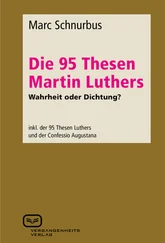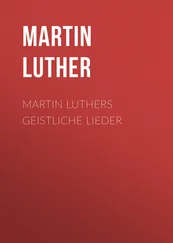Reinhold Rieger - Martin Luthers theologische Grundbegriffe
Здесь есть возможность читать онлайн «Reinhold Rieger - Martin Luthers theologische Grundbegriffe» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Martin Luthers theologische Grundbegriffe
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Martin Luthers theologische Grundbegriffe: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Martin Luthers theologische Grundbegriffe»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dieses Lehrbuch bietet eine Auswahl der wichtigsten theologischen Grundbegriffe Luthers, dargeboten anhand von Zitaten, die in der Weimarer Ausgabe nachgewiesen werden.
Es füllt die Lücke zwischen Konkordanzen und systematisierenden Darstellungen der Theologie Luthers und ist für Studierende, aber auch für PfarrerInnen oder ReligionslehrerInnen gedacht.
Martin Luthers theologische Grundbegriffe — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Martin Luthers theologische Grundbegriffe», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
4. Deutung: Wenn auch die Figuren fleischlich klingen, werden sie doch jetzt geistlich verstanden (4, 173, 40). Die Figur gehört in die leibliche, die Deutung in die geistliche Welt (8, 388, 19f.). Niemand anderes darf die Figur auslegen als der heilige Geist selbst, der die Figur gesetzt und Erfüllung gebracht hat, auf dass Wort und Werk, Figur und Erfüllung und beider Erklärung Gottes selbst, nicht der Menschen sind, auf dass unser Glaube auf göttliche, nicht menschliche Werke und Worte gegründet sei (6, 304, 11–14). In keiner Schrift, am wenigsten in der göttlichen, darf man mit reiner Willkür Figuren annehmen, sondern muss sie vermeiden und sich auf die einfache, reine und nächstliegende Bedeutung der Wörter stützen, es sei denn, der Zusammenhang selbst oder eine offenbare Absurdität zwingen dazu, eine Figur zu erkennen (8, 63, 27–30). Die Deutung der Figur kann dreierlei Weise geschehen. Zum ersten, wenn die Schrift selbst deutet. Solche Deutungen zwingen und sind Artikel des Glaubens. Die andere ist, wo die Schrift nicht selbst deutet, sondern da jeder gläubiger Verstand die Figur einführt und gründet um ihres Gleichnisses willen auf etliche klare Sprüche. Die dritte Weise ist eine bloße Deutung aus eigenem Gutdünken, wo die Figur allein ist und sonst nichts davon in der Schrift steht. Diese Deutung ist Irrtum (8, 386, 31–387, 15). Das, was dunkel mit Figuren gesprochen ist, sollen wir deuten mit dem, was ohne Figuren und einfach gesprochen ist (13, 638, 17–29).
5. Gebrauch: Augustin sagte: eine Figur beweist nichts (9, 456, 12; vgl. 7, 649, 28; 8, 63, 26; 154, 1f.; 345, 18; 346, 33f.). Aus bloßer Figur etwas zu begründen oder beweisen, ist falsch, da die Figur erst nach der erfolgten Erfüllung als Hinweis auf sie verstanden werden kann (8, 346, 13–22). Deshalb nützt sie nichts in theologischen Auseinandersetzungen oder zur Erbauung des Glaubens. Denn Figuren und Deutungen sind nicht genug, den Glauben zu begründen, er muss zuvor gegründet sein mit klarer Schrift, einfältig verstanden nach Laut und Meinung der Worte. Nach solchen Worten und Grund des Glaubens sind solche Deutungen der Geschichten auf den Glauben zu bauen (10I.1, 417, 12–16).
|74|📖 Anna Vind, Über die theologische Verwendung rhetorischer Figuren bei Luther, in: Oswald Bayer, Hg., Creator est Creatura, 2007, 95–124.
[Zum Inhalt]
Fleisch/Geist
→ alt/neu, Leib/Seele, Mensch, Sünde
1. Fleisch wird nicht nur als Sinnlichkeit oder Begierde des Fleisches verstanden, sondern als alles das, was ohne die Gnade und den Geist Christi ist (2, 509, 21f.). Die Scholastiker unterscheiden Fleisch und Geist metaphysisch als zwei Substanzen, wo doch der ganze Mensch Geist und Fleisch ist, Geist, insofern er das Gesetz Gottes liebt, Fleisch, insofern er das Gesetz Gottes hasst (2, 415, 7–10). Mit Fleisch wird der ganze Mensch bezeichnet, mit Geist ebenso der ganze, und man muss unterscheiden den inneren und den äußeren Menschen oder den neuen und den alten nicht gemäß der Unterscheidung von Seele und Leib, sondern gemäß dem Affekt. Denn die Frucht und die Werke des Geistes sind Friede, Glaube, Beständigkeit usw. und dies geschieht im Leib (2, 588, 30–33). Mit dem Wort Fleisch wird der alte Mensch bezeichnet, nicht nur, weil er durch sinnliches Begehren getrieben ist, sondern auch, wenn er fromm, weise, gerecht ist, weil er nicht aus Gott durch den Geist wiedergeboren ist (1, 146, 14–16). Unser Fleisch wird in der ersten Sünde durch zwei Wunden schwer geschlagen. Die erste ist die Reizbarkeit zum Bösen, die zweite die Begierde. Diese beiden Wunden werden uns durch die Gebote erkennbar, aber durch die Gnade geheilt (1, 484, 32–34). Die Weisheit des Fleisches, die Sinnlichkeit genannt wird, ist Selbstsucht, d.h. wenn die Vernunft anstrebt, was ihr recht und gut erscheint, obwohl sie das nicht vermag und von Gott erbitten muss, damit sie von seinem Geist belehrt werde, was nicht bloß recht und gut zu sein scheint, sondern ist (1, 34, 1–4). Fleisch heißt die Schrift den ganzen Menschen, wie er von Vater und Mutter geboren ist, leben, wirken, denken, reden und tun kann. Das alles ist nichts anderes als Fleisch, das ist, ohne Geist. Ohne Geist sein heißt nichts anderes als in Gottes Reich nicht kommen können, das ist, in Sünden unter Gottes Zorn, zum ewigen Tod verdammt sein (21, 532, 29–38; vgl. 22, 133, 29–39). Man muss verstehen, dass der Mensch mit Vernunft und Willen, inwendig und auswendig, mit Leib und Seele Fleisch heißt, darum, dass er mit allen Kräften auswendig und inwendig nur sieht, was fleischlich ist und was dem Fleisch wohl tut (12, 373, 18–34). Das Wörtlein Fleisch muss man so verstehen, dass der ganze Mensch Fleisch heiße, wie er lebt, wie er auch ganz Geist heißt, wenn er nach dem trachtet, was geistlich ist (12, 376, 4–6). In der heiligen Schrift wird Geist genannt, was vom heiligen Geist ist, und Fleisch heißt, was vom Fleisch geboren ist. Was nun aus der Vernunft ist, heißt alles Fleisch. Derhalben sind Fleisch die Allerklügsten und Gewaltigsten auf Erden (33, 257, 1–39). Fleisch bedeutet also die ganze Natur des Menschen mit seinem Verstand und allen seinen Kräften. Deshalb bedeutet für Paulus Fleisch die höchste Gerechtigkeit, Weisheit, Kult, Religion, Verstand, Wille, die in der Welt sein können (40I, 244, 14–23).
2. Einheit des Menschen aus Fleisch und Geist: Luther sagt: Ich trenne Fleisch, Seele und Geist überhaupt nicht. Denn das Fleisch begehrt nicht außer durch Seele und Geist, wodurch es lebt, aber unter Geist und Fleisch verstehe ich den ganzen Menschen, besonders die Seele selbst. Derselbe Mensch, dieselbe Seele, derselbe Geist |75|des Menschen, ist, insofern er das, was Gottes ist, versteht, Geist, insofern er von den Verführungen des Fleisches bewegt wird, Fleisch, so dass er, wenn er dem zustimmt, ganz Fleisch ist. Man darf sich also nicht zwei verschiedene Menschen vorstellen. Es ist der ganze Mensch, der die Keuschheit liebt, derselbe ganze Mensch wird durch die Verführungen der Begierde gereizt. Es sind zwei ganze Menschen und ein ganzer Mensch. Daher kommt es, dass der Mensch gegen sich selbst kämpft und sich widerstreitet, will und nicht will. Aber das ist der Ruhm der Gnade Gottes, dass sie uns selbst zu unseren Gegnern macht (2, 585, 31–586, 18). Ein einziger Mensch findet in sich selbst zwei Stücke: durch den Geist will er das Gute und dient dem Gesetz Gottes und ist fromm, hat auch Lust und Liebe darin, aber durch das widerspenstige Fleisch will er das Böse und hat Liebe und Lust darin, demselben zu dienen. Weil Fleisch und Geist ein Mensch sind, so wird ihm zugerechnet beides, obwohl sie widereinander sind. Des Geistes halben ist er fromm, des Fleisches halben hat er Sünde. Denn weil das edelste, beste, höchste Stück des Menschen, der Geist, durch den Glauben fromm und gerecht bleibt, rechnet ihm Gott die übrige Sünde des geringsten Stücks, des Fleisches, nicht zur Verdammnis (7, 331, 32–333, 7). Das Fleisch neigt sich nach unten, der Geist strebt zum Himmel, und ist dennoch ein Mensch, nicht eine doppelte Person, die verschiedene Affekte hätte im Fleisch und im Geist, also der Sünde und des guten Lebens (34II, 198, 28–31).
3. Gegensatz: Den Streit unseres Fleisches und Geistes mit widerspenstigen Begierden legt Gott auf allen, die er getauft sein und berufen lässt. Daher streiten Geist und Fleisch widereinander, aber der Geist soll mit Mühe und Arbeit obsiegen und das ungehorsame Fleisch unterdrücken. Es ist offenbar, dass noch Sünde in den Getauften und Heiligen bleibt, so lange sie Fleisch und Blut haben und auf Erden leben (7, 331, 3–15; vgl. 6, 244, 14–21). Woher kommt aber solcher Streit des Bösen wider das Gute in uns selbst als von der leiblichen Geburt Adams, welche nach dem angefangenen guten Geist in der Taufe und Buße übrigbleibt, bis dass es durch Widerstreit und Gottes Gnaden und des Geistes Zunehmen überwunden und zuletzt durch den Tod erwürgt und ausgetrieben werde (7, 331, 25–29). Weil wir alle mit Christus der Welt und dem Fleisch abgestorben sind, so sollen wir hinfort nicht mehr nach dem Fleisch oder fleischlich leben noch denken (26, 310, 30–311, 24).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Martin Luthers theologische Grundbegriffe»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Martin Luthers theologische Grundbegriffe» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Martin Luthers theologische Grundbegriffe» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.