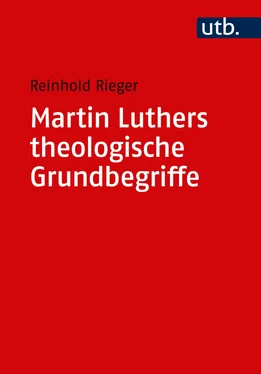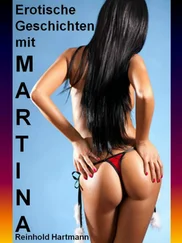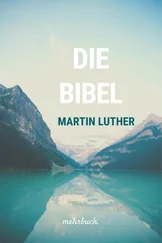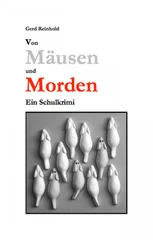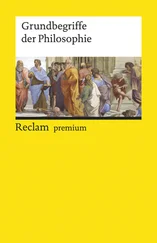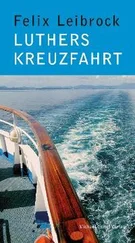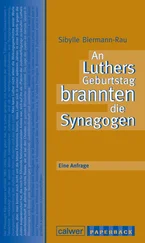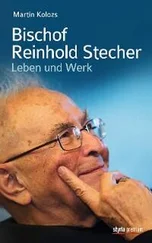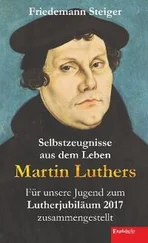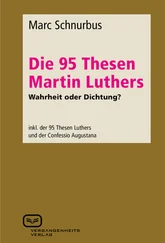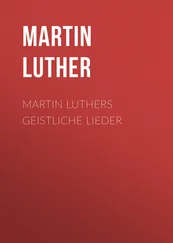Reinhold Rieger - Martin Luthers theologische Grundbegriffe
Здесь есть возможность читать онлайн «Reinhold Rieger - Martin Luthers theologische Grundbegriffe» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Martin Luthers theologische Grundbegriffe
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Martin Luthers theologische Grundbegriffe: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Martin Luthers theologische Grundbegriffe»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dieses Lehrbuch bietet eine Auswahl der wichtigsten theologischen Grundbegriffe Luthers, dargeboten anhand von Zitaten, die in der Weimarer Ausgabe nachgewiesen werden.
Es füllt die Lücke zwischen Konkordanzen und systematisierenden Darstellungen der Theologie Luthers und ist für Studierende, aber auch für PfarrerInnen oder ReligionslehrerInnen gedacht.
Martin Luthers theologische Grundbegriffe — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Martin Luthers theologische Grundbegriffe», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2. Der Glaube hängt außerhalb dieser Welt an Gott, Gottes Wort und seiner Barmherzigkeit und rechtfertigt den Menschen weder durch Werke noch irgendein weltliches Ding, sondern durch die ewige, unsichtbare Gnade Gottes. Darum ist er nicht Element dieser Welt, sondern die Fülle der ewigen Güter. Obwohl er auch zeitlich, |71|äußerlich wirkt, so weiß er doch von keinem weltlichen Ding. Denn er wirkt frei darin (10I.1, 350, 2–11).
3. Sollte nun Christus ein Herr sein, sollte seine Herrschaft nicht zeitlich noch leiblich sein, sondern er musste über das ganze Volk regieren, das vergangen, gegenwärtig und zukünftig war; darum musste er ein ewiger Herr sein, das kann gewiss nur geistlich zugehen (10I.1, 600, 3–6). Christus musste durch den Tod dieses sterbliche Leben lassen und durch Auferstehen ein unsterbliches annehmen und er ist ein wahrhaftiger lebendiger Mensch und doch unsterblich, ewig unsichtbar und regiert also geistlich im Glauben (11, 328, 15–19).
4. Nach der Auferstehung wird ein ewiges Leben der Heiligen und ewiges Sterben der Sünder sein (7, 220, 1f.). Auf dem V. Laterankonzil wurde zurecht beschlossen, dass die Seele des Menschen unsterblich sei, womit erinnert wird an das Bekenntnis: ‚ich glaube ein ewiges Leben‘ (7, 425, 22–25), ja auch der Leib muss wiederkommen, wie wir im Glauben bekennen: ‚Ich glaube eine Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben‘ (10I.1, 56, 19–23).
5. Christus will im Abendmahl nicht zeitlich, sondern geistlich und ewiglich geholfen haben durch seine Worte und Werke (7, 695, 24f.). Das Abendmahlsbrot speist zu einem unsterblichem ewigen Wesen, wie Christus sagt: Wer dies Brot isst, wird ewig leben (2, 109, 20–24).
📖 Heinrich Heimler, Aspekte der Zeit und Ewigkeit bei Luther, in: LuJ 40 (1973) 9–45.
[Zum Inhalt]
Exempel
→ Geschichte
1. Exempel und Historien geben und lehren allzeit mehr, als die Gesetze und das Recht: dort lehrt die gewisse Erfahrung, hier lehren unerfahrene, ungewisse Worte (6, 261, 20–22; vgl. 50, 383, 2–13). Äußere Beispiele bewegen nicht genug, da sie nicht empfunden werden und nicht lebendig sind; das innere Beispiel aber wird innerlich empfunden, lebt und lehrt in wirksamster Weise, nicht durch Buchstaben, Worte, Gedanken, sondern durch den Sinn der Erfahrung (2, 577, 30–33). An Exempel ist die Bibel voll, die nichts anderes als Gottes Werke und Wort lehrt, Menschenwerk und -wort verwirft (7, 594, 27–29). Dass niemand mit Werken zu Gott kommen und selig werden möge, als durch den Glauben, das treibt die Schrift in allen Exempeln und Lehren durch und durch (12, 403, 4–6). Die Schrift gewährt nicht nur Tröstungen der Verheißungen, sondern auch vielerlei Beispiele und Geschichten, durch die der Glaube an Gott genährt und befestigt wird (31II, 643, 28f.).
2. Christus als Exempel: Sein Wort und Werk soll in allem Leben ein kräftiges Exempel und Spiegel aller Tugenden sein (6, 15, 32–34; vgl. 275, 31–34). Aber man soll nicht aus Christus einen Mose machen, so dass er nicht mehr als lehre und Exempel gebe, wie es die anderen Heiligen tun, als sei das Evangelium eine Lehre oder Gesetzbuch. Darum sollst du Christus, sein Wort, Werk und Leiden in zweierlei Weise erfassen. Einmal als ein dir vorgetragenes Exempel, dem du folgen sollst. Das Hauptstück und der Grund des Evangeliums aber ist, dass du Christus zuvor, ehe du ihn zum |72|Exempel fassest, aufnimmst und erkennst als eine Gabe und Geschenk, das dir von Gott gegeben und dein eigen sei (10I.1, 10, 20–11, 15). Wenn du nun Christus so hast zum Grund und Hauptgut deiner Seligkeit, dann folgt das andere Stück, dass du ihn auch zum Exempel fasst, ergibst dich auch also deinem Nächsten zu dienen, wie du siehst, dass er sich dir ergeben hat. Christus als eine Gabe nährt deinen Glauben und macht dich zum Christen. Aber Christus als ein Exempel übt deine Werke, die machen dich nicht zum Christen, sondern sie gehen von dir aus als Christ, der schon zuvor zu einem solchen gemacht wurde (10I.1, 12, 12–20; vgl. 475, 3–16; 10I.2, 15; 22; 37f.; 247f.; 12, 372). Das andere, das dies Vorbild so hoch und unvergleichlich macht, ist, dass er nicht für sich selbst, auch nicht allein zum Exempel, sondern für uns gelitten hat. Das ist nun am allerwenigsten zu erlangen, mit diesem Stück hat Christus kein Exempel hinterlassen und es kann ihm niemand hierin nachfolgen, sondern er ist es allein, der für alle gelitten hat (21, 301, 28–36). Wir leugnen nicht, dass die Frommen Christi Beispiel nachahmen und gut handeln sollten, aber dadurch werden sie nicht gerecht vor Gott (40I, 389, 16f.).
3. Deutung: Darum lassen wir kein Exempel zu, auch von Christus selbst nicht, geschweige von andern Heiligen, es sei denn Gottes Wort dabei, das uns deute, welchen wir folgen oder nicht folgen sollen. Wir wollen am Werk und Exempel nicht genug haben, ja wir wollen keinem Exempel folgen, das Wort wollen wir haben, um welches willen alle Werke, Exempel und Wunder geschehen (18, 114, 25–30).
4. Die Exempel der Apostel sind die höchsten und nächsten vor allen Heiligen, die uns am besten unterweisen und Christus aufs klarste lehren (10I.2, 57, 11–26). Sie haben uns lauter gepredigt den Glauben, ihr Exempel allein dazu geordnet und dienen lassen, dass Christus in uns regiert und der Glaube lauter bliebe, dass wir nicht ihr Wort und Werk aufnehmen, als wäre es ihr Ding, sondern dass wir Christus in beidem, ihren Worten und Werken, lernten (10I.2, 58, 5–9).
5. Es ist gesagt, wie die Heiligen vielmals irren in menschlichen Lehren und Werken. Darum will Gott nicht, dass wir auf ihr Exempel, sondern auf seine Schrift sehen sollen (10I.1, 605, 12–14).
6. Der Beweis des Glaubens geschieht nur durch das Beispiel der ganzen Kirche in der Welt (2, 431, 30f.; vgl. 5, 532, 30–33).
7. Es ist falsch, dass man die Evangelien und Epistel achtet gleich wie Gesetzbücher, darin man lernen soll, was wir tun sollen, und die Werke Christi nicht anders denn als Exempel uns vorgebildet werden (10I.1, 9, 1–3).
📖 Dietrich Rössler, Beispiel und Erfahrung. Zu Luthers Homiletik, in: ders., / Hans Martin Müller, Hg., Reformation und Praktische Theologie, 1983, 202–215.
[Zum Inhalt]
Figur
→ Allegorie, Bild, Metapher, Zeichen
1. Die heilige Schrift verwendet sehr häufig grammatische Figuren, Synekdoche, Metalepse, Metapher, Hyperbole, ja in keiner anderen Schrift gibt es mehr Figuren. Auch wenn ‚Himmel‘ in der ganzen Schrift ein einfaches und eindeutiges Wort ist, das jenes hohe Firmament bezeichnet, wird er doch im Ps 19 als Metapher für die Apostel |73|verwendet. Was die Erde als einfaches Wort bedeutet, weiß jeder, metaphorisch bedeutet es die durch Laster und Böses niedergetretenen Gottlosen (8, 83, 32–37). Wo eine Figur, Symbol oder Gleichnis sein soll, da eines das andere bedeuten soll, da muss ja etwas gleiches in beiden angezeigt werden, darauf das Gleichnis stehe (26, 391, 29–31).
2. Das Alte Testament ist eine Figur des Neuen Testaments gewesen (6, 302, 21). Die Figuren des Alten Testaments gaben keine Gnade, aber sie heißen nicht Sakramente, denn in den Figuren war kein Wort oder Zusagung Gottes, was sein muss, wo ein Sakrament sein soll, sondern sie waren bloße Figuren oder Zeichen (7, 327, 22–29).
3. Figur und Erfüllung der Figuren verhalten sich gegeneinander wie ein leibliches und geistliches oder äußerliches und innerliches Ding, da man die Erfüllung von allem, was man in der Figur mit leiblichen Augen gesehen hat, allein mit dem Glauben sehen kann (6, 302, 31–34; 303, 12–15). Das alte Gesetz und seine Figuren müssen im neuen erfüllt werden (6, 304, 29f.). Wer die Erfüllung nicht zuvor in der Schrift beweisen kann, der nimmt seinen eigenen Traum für die Figur, denn aller Figuren Erfüllung steht im Neuen Testament (8, 347, 24–29; 386, 17–21). Das alte Testament hat gedeutet auf Christus, das neue aber gibt uns nun das, was vorher im alten verheißen und durch die Figuren bedeutet gewesen ist. Darum sind die Figuren aufgehoben, denn dazu haben sie gedient, dass jetzt vollendet ist und ausgerichtet und erfüllt, was darin verheißen ist (12, 275, 26–30).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Martin Luthers theologische Grundbegriffe»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Martin Luthers theologische Grundbegriffe» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Martin Luthers theologische Grundbegriffe» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.