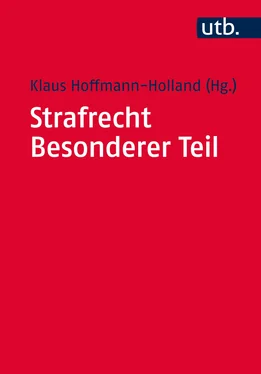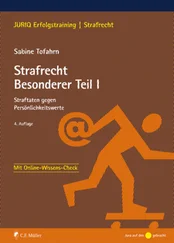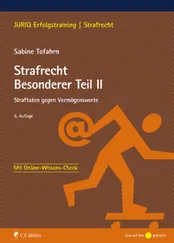202In Nr. 2wird der Verlust eines wichtigen Glieds des Körpersoder die dauernde Unbrauchbarkeit eines wichtigen Glieds des Körpers als schwere Folge normiert. »Glied des Körpers ist ein nach außen in Erscheinung tretender Körperteil, der mit dem Körper oder einem anderen Körperteil verbunden ist.«[355] Organe als innere Körperteilefallen folglich nicht unter diesen Begriff.[356] Umstritten ist, ob das Wort Glied voraussetzt, dass der entsprechende Körperteil durch ein Gelenk mit dem Körper verbunden ist.[357] Bejaht man dies, fallen nur bewegliche Teile wie Arme, Beine und Finger unter § 226 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Die Gegenauffassung will stattdessen darunter alle Körperteile fassen, die in sich abgeschlossen sind und eine besondere Funktion für den Gesamtorganismus erfüllen.[358] Dagegen spricht jedoch, dass dies den Wortlaut der Norm überschreitet und die sonstigen Begehungsvarianten, insbesondere die dauerhafte Entstellung, überflüssig machen würde.[359]
203Ein Glied im Sinne des § 226 Abs. 1 Nr. 2 StGB ist wichtig, »wenn es für den Gesamtorganismus eine besondere Funktion erfüllt.«[360] Aber aus welcher Perspektive ist dies zu entscheiden? Eine objektiv-generelle Bestimmung, wie sie das Reichsgericht in seiner Rechtsprechung vorgenommen hat, würde bedeuten, dass man unabhängig vom konkret betroffenen Körper sagen könnte, welche Körperteile wichtig im Sinne des § 226 StGB sind.[361] Es kommt aber auch eine soziale Betrachtung in Frage, die miteinbezieht, wie die konkrete Person ihren Körper nutzt.[362] Danach würde es einen Unterschied machen, ob jemand das verlorene Körperteil zur Ausübung seines Berufs braucht oder nicht. Der BGH hat sich zu Recht für die Einbeziehung individueller Eigenschaftendes Betroffenen entschieden: »§ 226 Abs. 1 Nr. 2 StGB ist ein konkretes |95|Verletzungsdelikt, dessen Erfolg auch von der jeweiligen körperlichen Beschaffenheit des Tatopfers abhängt. So hat ein Finger der linken Hand naturgemäß für einen Linkshänder eine größere Bedeutung als für einen Rechtshänder. Für einen Menschen ohne Hände, etwa infolge einer körperlichen Behinderung, der gelernt hat, seine Zehen als Fingerersatz einzusetzen, sind diese Zehen für das Hantieren ebenso wichtig wie die Finger für einen nicht behinderten Menschen […]. Solche dauerhaften körperlichen Besonderheiten eines Tatopfers bei der Auslegung des Tatbestandsmerkmals der Wichtigkeit eines Körperglieds […] gänzlich außer Acht zu lassen, widerspräche dem heutigen Verständnis eines gleichberechtigten Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher körperlicher Beschaffenheit.«[363]
204Ob ein Glied durch die Tat dauerhaft unbrauchbargeworden ist, hängt davon ab, »ob als Folge der vorsätzlichen Körperverletzung so viele Funktionen ausgefallen sind, dass das Körperglied weitgehend unbrauchbar geworden ist und von daher die wesentlichen faktischen Wirkungen denjenigen eines physischen Verlustes entsprechen«.[364]
205In Nr. 3des Abs. 1 findet sich ein Auffangtatbestand, der weniger konkret als die NRn. 1 und 2 als schwere Folge anerkennt, wenn das Körperverletzungsopfer »in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder Behinderung verfällt«. Der Unrechtsgehalt gerade bei der dauerhaften Entstellung muss den in Nr. 1 und 2 erfassten Folgen entsprechen. Um »die Anwendung des Strafrahmens des § 226 Abs. 1 StGB [zu] rechtfertigen […], dürfen nur solche Verunstaltungen des Gesamterscheinungsbildes des Verletzten als tatbestandsmäßig eingestuft werden, die im Maß ihrer beeinträchtigenden Wirkung zumindest der in ihrem Gewicht geringsten der übrigen in § 226 Abs. 1 StGB genannten Folgen (z.B. Verlust des Sehvermögens, des Sprechvermögens, Siechtum, Lähmung, geistige Krankheit, Behinderung) in etwa gleichkommen […].«[365]
206Die Körperverletzung mit Todesfolge gem. § 227 StGB ist eine Erfolgsqualifikation, so dass auch hier § 18 StGB zur Anwendung kommt. Danach muss die schwere Folge – hier der Tod – mindestens fahrlässig herbeigeführt werden. Da die Fälle der vorsätzlichen Herbeiführung des Todes unter die §§ 211ff. StGB fallen, erfasst § 227 StGB faktisch nur Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinationen. In Hinblick auf den Grundtatbestand stellt sich bezüglich § 225 Abs. 1 Alt. 1 StGB (Quälen) dieselbe Frage wie bei § 226 StGB (vgl. oben Rn. 198).
207Im Zusammenhang mit dem tatbestandsspezifischen Gefahrzusammenhang, der bei Erfolgsqualifikationen stets zur Kausalität hinzutreten muss, besteht bei § 227 StGB ein Streit darüber, ob der Tod Folge der Körperverletzungshandlung |96|(so die Rechtsprechung) oder des Körperverletzungserfolges (so viele Stimmen in der Literatur) sein muss.[366] Grundlegende Ausführungen zu seiner »Handlungslösung« machte der BGH anhand des folgenden Falles (»Gubener Hetzjagd«): Eine Gruppe Rechtsradikaler trifft, als sie des nachts mit drei Autos eine Straße in der brandenburgischen Stadt Guben entlang fährt, auf mehrere männliche Personen, die sie als Ausländer identifizieren. Die Rechtsradikalen schneiden ihnen den Weg ab, springen aus den Wagen und rennen laut schreiend auf diese Personen zu. Die angegriffenen Männer flüchten. Dabei tritt einer von ihnen voller Panik eine Glasscheibe in einer Haustür ein, um in dem Haus Schutz zu suchen. Dabei verletzt er sich an einer Schlagader am Bein und verblutet binnen kürzester Zeit. Der BGH bejahte eine Strafbarkeit der Verfolger wegen versuchter Körperverletzung mit Todesfolge: § 227 StGB setzt unter anderem voraus, dass der Tod der verletzten Person »durch die Körperverletzung (§ 223 bis § 226)« verursacht worden ist […]. Dabei reicht es nicht aus, dass zwischen der Körperverletzungshandlung und dem Todeserfolg überhaupt ein ursächlicher Zusammenhang besteht, die Körperverletzung also nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass damit zugleich der Tod des Verletzten entfiele. § 227 StGB soll allein der mit der Körperverletzung verbundenen Gefahr des Eintritts der qualifizierenden Todesfolge entgegenwirken. Die genannte Vorschrift erfasst deshalb nur solche Körperverletzungen, denen die spezifische Gefahr anhaftet, zum Tode des Opfers zu führen; gerade diese Gefahr muss sich im tödlichen Ausgang niedergeschlagen haben […]. Eine solche deliktsspezifische Gefahr kann auch schon von der bloßen Körperverletzungshandlung ausgehen[…]. Der Wortlaut der Bestimmung steht einer solchen Auslegung nicht entgegen […]. Auch der Gesetzgeber ist dieser Rechtsprechung nicht entgegengetreten. Vielmehr hat er § 227 I StGB durch den Zusatz »(§ 223 bis § 226)« ergänzt […], ohne […] die in §§ 223, 224, 225 StGB enthaltenen versuchten Körperverletzungsdelikte (jeweils Abs. 2) vom Anwendungsbereich des § 227 StGB auszunehmen […]. Mithin ist der Versuch einer Körperverletzung mit Todesfolge auch in Form eines »erfolgsqualifizierten Versuchs« möglich.«[367] Der BGH schließt also aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber auch versuchte Körperverletzungen für »qualifikationsfähig« im Sinne des § 227 StGB hält, dass es nicht auf den Körperverletzungs erfolg ankommen könne (den gibt es beim Versuch noch nicht). Es müsse sich die Gefährlichkeit der Körperverletzungs handlung in der schweren Folge realisieren.
208Der Letalitätstheoriegenannte Standpunkt aus der Literatur hält dem BGH entgegen, dass der Wortlaut des § 227 StGB eindeutig für seine Ansicht spreche: »Die Körperverletzung« müsse den Tod »der verletzten Person« verursachen und damit könne sprachlich nur der Körperverletzungs erfolg gemeint sein. Dieser müsse sich zu der besonders schweren Folge, dem Tod, »weiterentwickeln«, |97|gewissermaßen vertiefen, denn nur dann sei der spezifische Gefahrenzusammenhang, der die erheblich erhöhte Strafandrohung rechtfertige, gegeben. [368]
Читать дальше