3.1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
3.2 Sozialgerichtsgesetz (SGG)
3.3 Finanzgerichtsordnung (FGO)
3.4 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG)
4. Strafrecht
4.1 Strafprozessordnung (StPO)
4.2 Jugendgerichtsgesetz (JGG)
1.3.3 Prozesskostenhilfe
Die Erfolgsaussichten eines Gerichtsprozesses sind oft schwer abzuschätzen. (Der Volksmund sagt dazu: „Vor den Gerichten ist es wie auf hoher See: man befindet sich allein in Gottes Hand.“) Die Gerichts- und Rechtsanwaltskosten hat grundsätzlich die unterlegene Partei zu tragen. Bei einem vor den Zivilgerichten geführten und verlorenen Prozess über mehrere Instanzen hinweg kann es vorkommen, dass die Gerichts- und Anwaltskosten die Höhe des Streitwertes erreichen oder gar überschreiten.
Auf der anderen Seite soll grundsätzlich aus finanziellen Gründen niemand davon abgehalten werden, vor Gericht sein Recht zu suchen und durchzusetzen. Deshalb gibt es die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe (PKH) nach den §§ 114 ff. ZPO zu beantragen (Näheres bei Wabnitz 2014a, Kap. 7.3; Trenczek et. al. 2014, Kap. I. 5.3.3, Kievel et. al. 2013, Kap. 22.1.4)
 Literatur
Literatur
Falterbaum, J. (2013): Rechtliche Grundlagen Sozialer Arbeit. 4. Aufl.
Kievel, W., Knösel, P., Marx, A. (2013): Recht für soziale Berufe. Basiswissen kompakt.
Kropholler, J. (2013): Bürgerliches Gesetzbuch – Studienkommentar. 14. Aufl.
Palandt, O. (2015): Bürgerliches Gesetzbuch. 74. Aufl.
Trenczek, T., Tammen, B., Behlert, W., Boetticher, A. von (2014): Grundzüge des Rechts. Studienbuch für soziale Berufe. 4. Aufl.
Wabnitz, R. J. (2014a): Grundkurs Recht für die soziale Arbeit. 4. Aufl.
1.4 Fall: Schlägerei und Schadensersatz
A und B sind verfeindet. Sie treffen sich zufällig spät abends in der Stadt. A sieht B zuerst, zieht ein Messer mit feststehender Klinge aus dem Halfter und sticht auf B ein, der ihn erst in diesem Moment erkennt. Der nicht bewaffnete B duckt sich in letzter Sekunde geschickt weg, sodass A ihn nicht trifft. Blitzschnell versetzt B dem A einen gezielten Faustschlag ins Gesicht, sodass A zu Boden geht, schwer im Gesicht verletzt wird und ins Krankenhaus gebracht werden muss.
1. Kann A von B Schadensersatz verlangen?
2. Kann B von A Schadensersatz verlangen?
(Die ebenfalls einschlägigen §§ 223 ff. StGB – Strafbarkeit von Körperverletzungen – sind hier nicht zu prüfen!)
2 Verfassungsrechtliche Grundlagen
2.1 Staatsprinzipien des Grundgesetzes
Gemäß Art. 20 Abs. 1GG ist die Bundesrepublik Deutschland „ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“, und gemäß Art. 20 Abs. 3GG ist die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und sind die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden. Aus diesen wenigen Verfassungsnormen ergeben sich fünf Staatsprinzipien des Grundgesetzes (GG) (siehe Übersicht 9sowie Näheres bei Wabnitz 2014a, Kap. 8.2; Hömig/Antoni 2013, Erläuterungen zu Art. 20; Kievel et. al. 2013, 2.1; Trenczek et. al. 2014, Kap. I. 2.1).
Übersicht 9
Staatsprinzipien des Grundgesetzes (GG)
1. Republik
2. Demokratie
3. Bundesstaat
4. Rechtsstaat
5. Sozialstaat
2.1.1 Republikanisches Prinzip und Demokratieprinzip
Das republikanische Prinzip (Hömig/Antoni 2013, Art. 20 Rz. 2) wird in Art. 28 Abs. 1Satz 1 GG sowie dadurch zum Ausdruck gebracht, dass an mehreren Stellen im Grundgesetz von „Bundesrepublik“ Deutschland die Rede ist. Dies bedeutet, dass es in Deutschland mit dem Bundespräsidenten ein gewähltes Staatsoberhaupt gibt – im Gegensatz zu Monarchien mit Fürsten, Königen oder Kaisern und Thronfolgeregelungen kraft Vererbung.
Das Wort „Demokratie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet Herrschaft des Volkes. Die Demokratie nach der Konzeption des Grundgesetzes ist gemäß Art. 20 Abs. 2Satz 1 und 2 GG eine mittelbare parlamentarische Demokratie (Hömig/Antoni 2013, Art. 20, Rz. 3): auf der Bundesebene erfolgen Wahlen zum Deutschen Bundestag, der die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler wählt und auf deren/dessen Vorschlag hin die BundesministerInnen vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen werden. Entsprechendes gilt auf der Ebene der Länder (Wahl der Landtage, MinisterpräsidentInnen, LandesministerInnen).
2.1.2 Bundesstaatsprinzip und Rechtsstaatsprinzip
Die Bundesrepublik Deutschland ist, ähnlich wie die Republik Österreich, ein Bundesstaat (Hömig/Antoni 2013, Art. 20, Rz. 6). In Kapitel 2.2wird dargestellt, was das Bundesstaatsprinzip konkret bedeutet.
Neben dem Bundesstaatsprinzip ist das Rechtsstaatsprinzip das älteste Staatsprinzip in Deutschland (Hömig/Antoni 2013, Art. 20 Rz. 10 ff.; Kievel et. al. 2013, 2.1.3; Trenczek et. al. 2014, I 2.2.2; Wabnitz 2014a, 8.2.4); siehe dazu Übersicht 10:
Übersicht 10
Das Rechtsstaatsprinzip bedeutet:
1. Machtdekonzentration durch Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2Satz 2 und Abs. 3GG) wie folgt:
1.1 Legislative = Gesetzgebung durch die Parlamente
1.2 Exekutive = Regierung und Verwaltung
1.3 Judikative = Rechtsprechung: Kontrolle der übrigen Gewalten anhand von Recht und Gesetz
2. Sicherung des Rechtsstaates durch:
2.1 allgemein geltende Grundrechte (Art. 1 bis 19 GG),
2.2 justizielle Grundrechte (Art. 101, 103, 104 GG),
2.3 Unabhängigkeit der Gerichte und Richter (Art. 97 GG)
2.4 Rechtsweggarantie (Art. 19 IV GG).
3. Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes wie folgt:
3.1 Geeignetheit einer Maßnahme, um Zweck zu erreichen?
3.2 Erforderlichkeit einer Maßnahme, um Zweck zu erreichen? (Oder gibt es ein „milderes Mittel“?)
3.3 Angemessenheit der Nachteile zum erstrebten Vorteil? (Abwägung unter Gewichtung von Nachteilen und Vorteilen.)
2.1.3 Sozialstaatsprinzip
Eines der jüngeren Staatsprinzipien ist schließlich das Sozialstaatsprinzip, das in Art. 20 Abs. 1sowie Art. 28 Abs. 1Satz 1 GG seinen Ausdruck gefunden hat, wenn auch nur in jeweils einem einzigen Wort: „sozialer“ (Bundesstaat) bzw. „sozialen“ (Rechtsstaates) (Hömig/Antoni 2013, Art. 20, Rz. 4; Kievel et. al. 2013, 2.1.5; Trenczek et. al. 2014, I 2.2.3; Wabnitz 2014a, 8.2.5). Zum Sozialstaatsprinzip siehe Übersicht 11:
Übersicht 11
Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1Satz 1 GG)
1. Der Staat ist zur Herstellung und Erhaltung von sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit verpflichtet, und zwar u. a. wie folgt:
1.1 Legislative:
1.1.1 Schaffung eines sozialen Mindeststandards
1.1.2 Gewährleistung des Existenzminimums
1.2 Exekutive:
1.2.1 bei Ermessen: Wahl der sozial gerechteren Maßnahme
1.2.2 Legitimation für Leistungen in Notfällen
1.3 Judikative: Wahl der sozial gerechteren Alternative
2. Das Sozialstaatsprinzip stellt eine „Generalklausel“ dar, die durch den Gesetzgeber konkretisiert werden muss (Ansätze dazu bereits im GG: Art. 6 Abs. 4, 9 Abs. 3, 14 Abs. 2, 15 GG).
3. Das Sozialstaatsprinzip wird konkretisiert in verschiedenen Politikbereichen, z. B. in der:
3.1 Sozialpolitik
3.2 Bildungspolitik
3.3 Gesundheitspolitik
3.4 Wohnungspolitik
3.5 Familienpolitik
3.6 Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik
Die wichtigste Konkretisierung des Sozialstaatsprinzips ist durch das Sozialgesetzbuch (SGB) erfolgt ( Kap. 4.1). Zum Sozialstaatsprinzip existiert eine umfangreiche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (z. B. BVerfGE 1, 105; 5, 198; 10, 370; 22, 204; 35, 235 f.; 52, 346; 82, 85; 94, 263; 100, 284; 110, 445; 123, 363).
2.2 Bildungsrecht und Föderalismus
2.2.1 Bund und Länder im deutschen Föderalismus
In Übersicht 12wird dargestellt, was das Bundesstaatsprinzip (Näheres bei Hömig/Antoni 2013, Art. 20, Rz. 6; Kievel et. al. 2013, 2.1.5; Trenczek et. al. 2014, I 2.2.3; Wabnitz 2014a, 8.2.5) bedeutet:
Читать дальше
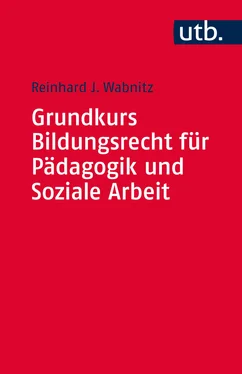
 Literatur
Literatur










