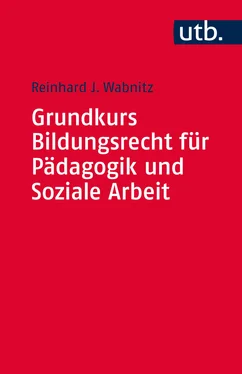Damit exakt klar wird, worüber man spricht und welche Rechtsnorm im Einzelnen gemeint ist, ist es unbedingt erforderlich, Gesetze und Paragrafen so präzise wie möglich zu zitieren, z. B.: „§ 9 Abs. 2S. 1“ mit nachfolgender Gesetzesbezeichnung, zumeist in Kurzform (z. B. BGB oder SGB I).
1.1.3 Objektive und subjektive Rechte
Für die gesamte Rechtsordnung ist es sodann wichtig, zwischen objektivem und subjektivem Recht bzw. objektiven und subjektiven Rechtsnormen zu unterscheiden (Näheres bei Wabnitz 2014a, Kap. 2.2). Unter objektivem Recht oder objektiven Rechtsnormen versteht man die gesamte Rechtsordnung bzw. die Gesamtheit der existierenden Rechtsnormen. Dazu zählen alle Gesetze wie z. B. das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch (SGB) oder das Schulgesetz des Landes X. Auf die dort enthaltenen objektiven Rechtsnormen kann sich der Einzelne allerdings nur berufen bzw. auf ihrer Grundlage nur dann Klage vor den Gerichten erheben, wenn ihm zusätzlich auch ein subjektives Recht, meist in Form eines (Rechts-)Anspruchs, zusteht. Zum Ganzen die Übersicht 3:
Übersicht 3
Objektive und subjektive Rechte
1. Objektives Recht
= die gesamte Rechtsordnung oder die Gesamtheit der Rechtsnormen oder bestimmte Rechtsnormen
2. Subjektive Rechte
= Rechte des Einzelnen, insbesondere (Rechts-)Ansprüche des Privatrechts (§ 194 BGB) oder des öffentlichen Rechts (z. B. §§ 24, 27 SGB VIII).
1.2 Zivilrecht und öffentliches Recht
1.2.1 Abgrenzung von Zivilrecht und öffentlichem Recht
Die verschiedenen Teilgebiete des Rechts werden in Deutschland traditionell entweder dem Zivilrecht (Privatrecht) oder dem Öffentlichen Recht zugeordnet (Näheres bei Wabnitz 2014a, Kap. 2). Diese Unterscheidung ist auch für die Pädagogik und die Soziale Arbeit von erheblicher Bedeutung und wird deshalb – in vereinfachter Form – in Übersicht 4erläutert:
Übersicht 4
Abgrenzung von Zivilrecht und Öffentlichem Recht
1. Zivilrecht (Privatrecht): Auf beiden Seiten einer Rechtsbeziehung stehen sich Privatpersonen (als natürliche oder juristische Personen des Zivilrechts) gegenüber.
2. Öffentliches Recht: Auf mindestens einer Seite einer Rechtsbeziehung befindet sich der „Staat“ (als Bundesrepublik Deutschland, als ein Bundesland, als eine Gemeinde oder ein Sozialversicherungsträger).
Das Zivilrecht (oder Privatrecht) regelt also die Rechtsbeziehungen der Bürgerinnen und Bürger untereinander, und zwar sowohl zwischen natürlichen Personen (Menschen) als auch sogenannten juristischen Personen des Privatrechts (z. B. eingetragener Verein/e. V. oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH). Das öffentliche Recht hingegen regelt die Rechtsbeziehungen zwischen BürgerInnen und Staat sowie auch die Organisation von Staat und Verwaltung und die Rechtsbeziehungen zwischen mehreren Trägern hoheitlicher Verwaltung untereinander, zum Beispiel mehreren Trägern der öffentlichen Jugendhilfe.
1.2.2 Rechtsgebiete des Zivilrechts
Die wichtigsten Rechtsgebiete des Zivilrechts (Näheres bei Kievel et. al. 2013, 3.2.2.1; Wabnitz 2014a, Kap. 2.4, 4) werden in Übersicht 5genannt:
Übersicht 5
Rechtsgebiete des Zivilrechts (oder Privatrechts)
1. Bürgerliches Recht (BGB)
1.1 Allgemeiner Teil (Buch 1)
1.2 Schuldrecht (Buch 2)
1.3 Sachenrecht (Buch 3)
1.4 Familienrecht (Buch 4)
1.5 Erbrecht (Buch 5)
2. Sonstiges Privatrecht, Arbeits- und Wirtschaftsrecht
2.1 Arbeitsrecht
2.2 Handelsrecht
2.3 Gesellschaftsrecht
2.4 Banken-, Kredit-, Versicherungsvertragsrecht
2.5 Wettbewerbsrecht
Das für die Pädagogik und die Soziale Arbeit wichtigste Gesetz des Zivilrechts ist das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), insbesondere dessen Viertes Buch Familienrecht ( Kap. 3).
1.2.3 Rechtsgebiete des öffentlichen Rechts
Dazu diese Übersicht 6:
Übersicht 6
Rechtsgebiete des öffentlichen Rechts
1. Völkerrecht, Recht der Europäischen Union
2. Staats- und Verfassungsrecht
3. Verwaltungsrecht
3.1 Allgemeines Verwaltungsrecht
3.2 Bildungsrecht als besonderes Verwaltungsrecht
3.3 Sozialrecht als besonderes Verwaltungsrecht
3.4 Steuerrecht als besonderes Verwaltungsrecht
3.5 Weitere Gebiete des besonderen Verwaltungsrechts
4. Strafrecht
5. Prozessrecht
Im Bereich des öffentlichen Rechts (Näheres bei Kievel et. al. 2013, 3.2.2.1; Trenczek et. al. 2014, III; Wabnitz 2014a, Kap. 2) sind für die Pädagogik und die Soziale Arbeit das Bildungsrecht und das Sozialrecht als Teile des (Besonderen) Verwaltungsrechts von zentraler Bedeutung ( Kap. 4bis 12), aber auch einzelne Artikel des Grundgesetzes ( Kap. 2). Teil des öffentlichen Rechts ist auch das einschlägige Prozessrecht ( Kap. 1.3).
1.3 Gerichtliche Rechtsverwirklichung
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein umfassend ausgebauter Rechtsstaat ( Kap. 2.1.2). Wird jemand „durch die öffentliche Gewalt“ in seinen Rechten verletzt, „so steht ihm der Rechtsweg offen“ (Art. 19 Abs. 4Satz 1 GG). Mit anderen Worten: Gegen nahezu alle Formen hoheitlichen Handelns kann sich der Bürger, soweit er in seinen Rechten betroffen ist, zur Wehr setzen, indem er ein Gericht anruft. Im Verhältnis zwischen Zivilpersonen untereinander gilt dies grundsätzlich ohnehin.
1.3.1 Gerichtsaufbau in der Bundesrepublik Deutschland
In Deutschland gibt es derzeit sieben Gerichtsbarkeiten (siehe dazu Übersicht 7; Näheres bei Kievel et. al. 2013, Kap. 22; Trenczek et. al. 2014, I 5.; Wabnitz 2014a, Kap. 7.1):
Übersicht 7
Vereinfachter Überblick über den Gerichtsaufbau in Deutschland
1. Verfassungsgerichtsbarkeit:
1.1 Bundesverfassungsgericht
1.2 Landesverfassungsgerichte (in den 16 Ländern)
2. Zivilgerichtsbarkeiten:
2.1 Allgemeine Zivilgerichtsbarkeit (Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof)
2.2 Arbeitsgerichtsbarkeit (Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht)
3. Öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeiten:
3.1 Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht/Verwaltungsgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht)
3.2 Sozialgerichtsbarkeit (Sozialgericht, Landessozialgericht, Bundessozialgericht)
3.3 Finanzgerichtsbarkeit (Finanzgericht, Bundesfinanzhof)
3.4 Strafgerichtsbarkeit (Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof)
Für Pädagogik, Bildungsrecht und Soziale Arbeit sind die Verwaltungsgerichtsbarkeit und die Sozialgerichtsbarkeit von besonderer Bedeutung (Kap. 4.3). „Über“ allen anderen Gerichtsbarkeiten steht die Verfassungsgerichtsbarkeit: das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf Fragen des Grundgesetzes, die 16 Landesverfassungsgerichte mit Blick auf Fragen der jeweiligen Landesverfassung. Das Bundesverfassungsgericht kann in der Regel erst dann angerufen werden, wenn der jeweilige Rechtsweg „ausgeschöpft“, also erfolglos durchlaufen worden ist.
In den meisten Gerichtsbarkeiten gibt es sogenannte (mehrstufige) „Instanzenzüge“: immer eine Eingangsinstanz, oft eine „Berufungsinstanz“ und als letzte Instanz ggf. die sogenannte „Revisionsinstanz“.
1.3.2 Gerichtliches Verfahrensrecht
Für jede der genannten Gerichtsbarkeiten gibt es spezielle Gerichtsverfahrens- oder Prozessgesetze (siehe Übersicht 8):
Übersicht 8
Gerichtsverfahrens- oder Prozessgesetze
1. Allgemein: Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) für die Organisation der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit (sog. „Ordentliche Gerichtsbarkeit“)
2. Zivilrecht
2.1 Zivilprozessordnung (ZPO)
2.2 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
2.3 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)
3. Öffentliches Recht
Читать дальше