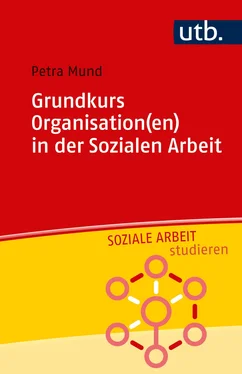2 Leistungen der Organisationen der Sozialen Arbeit

Die Hilfe- und Unterstützungsleistungen für Individuen, Familien und Gruppen in sozialen Notlagen können grundsätzlich in Geld-, Sach- und Dienstleistungen differenziert werden. In den Organisationen der Sozialen Arbeit erbringen die Fachkräfte individuelle und persönliche Hilfen, die von einer zwischenmenschlichen Interaktion gekennzeichnet sind. Daher werden die Leistungen der Sozialen Arbeit, wie die stationäre Betreuung in der Kinder- und Jugendhilfe oder ambulante Beratungsangebote, auch als personenbezogene soziale Dienstleistungen bezeichnet. Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der personenbezogenen sozialen Dienstleistungen und den damit verbundenen Herausforderungen ist für die organisationsbezogene Gestaltung wichtig. Andernfalls laufen die Organisationen der Sozialen Arbeit Gefahr, sich bei der Gestaltung und Strukturierung ihrer Abläufe nicht auf die Besonderheiten ihres Gegenstandes zu beziehen, sondern ausschließlich allgemeine organisationstheoretische Überlegungen in den Vordergrund zu stellen.

Welche unterschiedlichen Leistungen der Organisationen der Sozialen Arbeit kennen Sie? Wie würden Sie diese systematisieren?
2.1 Leistungen der Organisationen der Sozialen Arbeit: Dienst-, Sach- und Geldleistungen
Zunächst ist die Frage zu beantworten, welche Leistungen von den Organisationen der Sozialen Arbeit für Einzelpersonen, Familien und Gruppen generell zur Verfügung gestellt werden. Daran anknüpfend ist zu klären, wie innerhalb dieses Leistungskanons die unterschiedlichen und vielfältigen Angebote der Sozialen Arbeit verstanden werden können.
Grundsätzlich können die unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Leistungen in Dienst-, Sach- und Geldleistungen differenziert werden (Ortmann 2012). Innerhalb dieses Dreiklangs werden die Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit zu den Dienstleistungen gerechnet.
Dieser Dreiklang findet sich auch im Sozialgesetzbuch. Im Sozialrecht, genauer gesagt in § 11 SGB I sind unter dem Oberbegriff Sozialleistungen die vielfältigen Hilfe- und Unterstützungsleistungen, die basierend auf dem Sozialstaatsprinzip ( Kap. 1) in sozialen und individuellen Problemlagen zur sozialen Sicherung von staatlicher Seite dem / der Einzelnen zur Verfügung gestellt werden, zusammengefasst und ebenfalls in Dienst-, Sach- und Geldleistungen differenziert. In diesem rechtlichen Kontext dienen Dienstleistungen der Verwirklichung sozialer Rechte.
„Sie sind Teil des wohlfahrtstaatlichen Sozialleistungssystems und stellen eine besondere Art (oder Form) rechtlich verbürgter Sozialleistungen dar“ (Bauer 2001, 29).

Sozialleistungen sind nach § 11 SGB I die im Sozialgesetzbuch für die soziale Sicherung vorgesehenen Dienst-, Sach- und Geldleistungen. Auf diese Sozialleistungen haben die jeweils Leistungsberechtigten bei Bestehen der Anspruchsvoraussetzungen einen Leistungsanspruch.

Beispiele für Geldleistungen sind die von der Rentenversicherung gezahlten Altersrenten (laufende Geldleistungen) oder die von der gesetzlichen Krankenversicherung gezahlten Zuschüsse zum Zahnersatz (einmalige Geldleistungen). Mit Sachleistungen ist die Bereitstellung von Gegenständen wie Arzneimitteln oder Pflegehilfsmitteln, etwa Rollatoren oder Pflegebetten, gemeint. Die vielfältigen Leistungen und Angebote in den verschiedenen Feldern der Sozialen Arbeit, wie beispielsweise Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII, sind Beispiele für Dienstleistungen.
Das Verhältnis zwischen Geld- und Sachleistungen wird immer wieder kritisch diskutiert. Ein Beispiel hierfür ist die Regelung in § 3 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), nach der der persönliche Bedarf der Leistungsberechtigten, das „Taschengeld“ für Fahrtkosten, Kommunikationsmittel u.Ä. anstelle durch Geldleistungen durch Sachleistungen gedeckt werden sollen, sofern dies mit vertretbarem Verwaltungsaufwand möglich ist. Dadurch kann sich die Situation ergeben, dass neu ankommende Asylsuchende als Leistungsberechtigte über kein Bargeld verfügen. Hiergegen wird die Kritik vorgebracht, dass diese Bedarfe sehr persönlicher Natur seien und daher mit Barmitteln individuell und frei befriedigt werden können sollten. Zudem seien Sachleistungen und das Fehlen von Bargeld in hohem Maße mit Stigmatisierung verbunden.
Ein Großteil der nach dem Sozialgesetzbuch vorgesehenen Sozialleistungen wird in Form von Geldleistungen wie beispielsweise Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung oder Elterngeld gewährt. In der Praxis ist die Abgrenzung der einzelnen Leistungsarten nicht immer einfach (Dahme / Wohlfahrt 2015). In der Sozialen Arbeit finden sich auch Mischformen, bei denen unterschiedliche Sozialleistungsarten miteinander kombiniert werden.

So umfasst die Unterbringung eines Jugendlichen in einer Jugendwohngemeinschaft neben der sozialpädagogischen Betreuung als Dienstleistung auch den notwendigen Unterhalt des Jugendlichen. Dabei soll gem. § 39 Abs. 2 SGB VIII der regelmäßig wiederkehrende Bedarf durch laufende Geldleistungen gedeckt werden. Darüber hinaus werden auch einmalige Geldleistungen, beispielsweise bei wichtigen persönlichen Anlässen oder für Urlaubs- und Ferienreisen, gewährt.
Der Schwerpunkt der Sozialen Arbeit und damit auch ihrer Organisationen liegt jedoch nicht auf der Auszahlung von Geldleistungen oder der Zurverfügungstellung von Sachleistungen. Entsprechend ihres Gegenstandsbereiches, der ganz allgemein mit der Bewältigung individueller und sozialer Problemlagen beschrieben werden kann (Schilling / Klus 2018), liegt der Schwerpunkt der Angebote und Leistungen der Sozialen Arbeit auf der Erbringung von individuellen Hilfe- und Unterstützungsleistungen. Diese Leistungen können als beruflich gerahmte und institutionalisierte Handlungen (Dienste) gegenüber anderen Personen und damit als Dienstleistung verstanden werden. Dabei sind charakteristische Merkmale des sozialarbeiterischen Handelns die persönliche Hilfe und zwischenmenschliche Interaktion (Bötticher / Münder 2011; Bommes / Scherr 2012). Dementsprechend werden die Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit auch als personenbezogene soziale Dienstleistung bezeichnet.
„Unter Sozialer Arbeit verstehen wir eine personenbezogene soziale Dienstleistung, die im sozialstaatlichen Rahmen zur Bearbeitung sozialer Probleme eingesetzt wird, damit AdressatInnen im gesellschaftlichen Interesse bei der Bewältigung von Lebensproblemen [...] unterstützt werden“ (Hammerschmidt et al. 2017, 13 f.).
2.2 Personenbezogene soziale Dienstleistungen: Begriff
Die vielfältigen, im Rahmen einer professionellen Tätigkeit erbrachten sozialarbeiterischen Leistungen und Angebote werden also auch als personenbezogene soziale Dienstleistungen bezeichnet. Um genauer zu klären, was damit gemeint ist, ist eine Auseinandersetzung mit dem schillernden und in vielen Disziplinen unterschiedlich diskutierten Begriff der Dienstleistung (Bauer 2001) sowie mit den Adjektiven „personenbezogen“ und „sozial“ geboten.

Erste Hinweise, was mit den Begriffen Dienstleistung und personenbezogene soziale Dienstleistung gemeint sein könnte, liefert eine alltagswissenschaftliche Herangehensweise. Überlegen Sie: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie über diese Begriffe bzw. die jeweiligen Bestandteile nachdenken? Reflektieren und diskutieren Sie die Bedeutungsinhalte der Begriffe bzw. der einzelnen Bestandteile.
Читать дальше