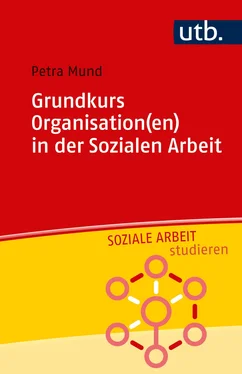Zudem handeln die Fachkräfte in diesen Organisationen. Um das eigene Handeln in Organisationen reflektieren, organisationsbedingte Phänomene und den Zusammenhang von Organisation und Professionalität in der Sozialen Arbeit verstehen zu können, ist daher auch eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Organisation als solche erforderlich. Darüber hinaus stehen die Organisationen der Sozialen Arbeit vor der Frage, wie sie ihre Abläufe und (Teil-)Aufgaben organisieren, damit die jeweiligen Organisationsziele möglichst effizient erreicht werden können und für die Mitarbeitenden eine gewisse Handlungssicherheit gegeben ist. Für diese Aufgabe der Organisationsgestaltung sind organisationstheoretische Kenntnisse hilfreich. Dabei ist es erforderlich, die Besonderheiten der Sozialen Arbeit, wie beispielsweise das doppelte Mandat, zu reflektieren, damit die jeweiligen Strukturen und Abläufe sich ermöglichend und nicht be- oder gar verhindernd auf das professionelle Handeln der Fachkräfte auswirken. Fachkräfte der Sozialen Arbeit benötigen also auch ein organisationsbezogenes Wissen. Zusammengenommen sind damit ein allgemeines Wissen über die Organisationen in der Sozialen Arbeit und ein spezifisches Wissen über Organisation in der Sozialen Arbeit zentrale Bestandteile von Professionalität.

Stellen Sie sich vor: In der Einführungswoche Ihres Bachelorstudiums der Sozialen Arbeit werden Ihnen an einem Vormittag der allgemeine Studienverlauf und die Modulübersicht vorgestellt. Von den vielen Theorien, Konzepten, Handlungsfeldern und Methoden, mit denen Sie sich in den nächsten Semestern auseinandersetzen sollen, und den umfangreichen Kompetenzen, die Sie in den Vorlesungen, Seminaren und Praxisphasen erwerben sollen, raucht Ihnen schon bald der Kopf. Gleichzeitig freuen Sie sich insbesondere auf die Veranstaltungen zum Auftrag der Sozialen Arbeit und zu ihren Zielgruppen. Auch auf die Auseinandersetzungen mit den Theorien und Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit sind Sie gespannt und hoffen, in diesen Seminaren das Handwerkszeug für Ihre spätere Arbeit in der Praxis zu lernen. Die Relevanz eines Moduls und seiner Inhalte erklärt sich Ihnen jedoch nicht unmittelbar: In diesem Modul geht es um die organisationsbezogenen, strukturellen und ökonomischen Grundlagen der Sozialen Arbeit. Zwar können Sie nachvollziehen, dass es wichtig ist, die Organisations- und Finanzierungsstrukturen der Sozialen Arbeit allgemein zu kennen. Aber mehr als Rahmenbedingungen für Ihr Handeln in der Sozialen Arbeit sind diese Strukturen doch nicht, oder? Was haben die Organisationsstrukturen darüber hinaus mit Ihren fachlichen Handlungsmöglichkeiten in der Praxis zu tun? Gibt es hier Zusammenhänge oder Wechselwirkungen und wenn ja, welche?
Überlegen und diskutieren Sie:
Welche Assoziationen und / oder ggf. Erinnerungen an Ihre Einführungswoche weckt das beschriebene Szenario in Ihnen?
Welchen Platz auf der Beliebtheitsskala nehmen organisationsbezogene Vorlesungen und Seminare bislang bei Ihnen ein und warum?
Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, dass Sie sich mit Organisation(en) in der Sozialen Arbeit befassen?
1.1 Organisationen sind allgegenwärtig
Organisation(en) sind in der Praxis der Sozialen Arbeit allgegenwärtig. Nicht zuletzt deswegen muss die Frage, warum sich (angehende) SozialarbeiterInnen mit Organisation(en) in der Sozialen Arbeit auseinandersetzen sollen, aus verschiedenen Perspektiven beantwortet werden. Zunächst eine naheliegende, quasi offenkundige Antwort: SozialarbeiterInnen sollten sich mit den Organisationen der Sozialen Arbeit befassen, weil die Institutionalisierung und damit eng verknüpft die Organisationstatsache seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine bedeutende Rahmenbedingung der Sozialen Arbeit ist. Institutionalisierung, ein aus der Soziologie stammender Begriff, umfasst in der Sozialen Arbeit die Prozesse zur sozial- und gesellschaftspolitischen, rechtlichen und mit beidem verbundenen organisatorischen Absicherung ihrer vielfältigen Angebote und Leistungen. Der Begriff der Institution wird generell und auch in der Sozialen Arbeit oft synonym mit dem der Organisation gebraucht. Institution und Organisation sind jedoch nicht ganz deckungsgleich. Der Begriff der Institution kann sich zwar auf Organisationen beziehen und konkrete, materielle, zweckgerichtete Einrichtungen (z. B. Parlament, öffentliche Verwaltung, Schulen) meinen. Darüber hinaus werden aus einer funktionalistischen Perspektive aber auch strukturerhaltende Elemente einer Gesellschaft wie beispielsweise die Ehe als Institutionen bezeichnet (Schubert / Klein 2011; Süß 2009).
Die um 1900 im deutschsprachigen Raum zunehmende Institutionalisierung der bis dato insbesondere im Bereich der Armenfürsorge ehrenamtlich und unsystematisch geleisteten Sozialen Arbeit ist zum einen auf die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls beginnende Verberuflichung von Sozialer Arbeit zurückzuführen (Hammerschmidt et al. 2017). Seitdem findet Soziale Arbeit in sich immer weiter ausdifferenzierenden, institutionellen und damit auch organisationsbezogenen Kontexten statt und die Organisationstatsache ist zu einem zentralen Merkmal professionalisierter Sozialer Arbeit geworden.

Die Organisationstatsache bezieht sich auf die Beobachtung, dass professionalisierte Soziale Arbeit immer in einer Organisation geschieht.
Diese Organisationstatsache ist nicht nur auf die Prozesse der zunehmenden Verberuflichung von Sozialer Arbeit zurückzuführen. Sie ist zum anderen auch darin begründet, dass es beginnend in der Mitte des 19. Jahrhunderts zum Aufbau der Sozialversicherung und damit einhergehend zu einer ebenfalls zunehmenden Institutionalisierung und staatlichen Verantwortungsübernahme für die Leistungen der Sozialen Arbeit gekommen ist.

Die Sozialversicherung ist der wichtigste Teil der sozialen Sicherung in Deutschland. Sie besteht aus folgenden fünf Zweigen: gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, gesetzliche Arbeitslosenversicherung, gesetzliche Pflegeversicherung.
Auf diese Entwicklungen geht das in Deutschland grundgesetzlich verankerte Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 bzw. Art. 28 GG) zurück.

Das im Grundgesetz verankerte Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, 28 GG) verpflichtet den Gesetzgeber, die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit und Sicherheit zu beachten und soziale Gegensätze auszugleichen.
Die mit dem Sozialstaatsprinzip verbundenen zentralen übergreifenden sozialpolitischen Zielsetzungen soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit (§ 1 SGB I) und die sich daraus im Sinne des Sicherstellungsauftrages (§ 17 SGB I) für die unterschiedlichen Sozialleistungsbereiche ableitenden konkreten Verpflichtungen und Aufgaben werden auch durch die vielfältigen Leistungen und Angebote der Sozialen Arbeit und ihrer Organisationen flankiert und realisiert. Diese Ziele sind damit in den Organisationen institutionalisiert. Aus dieser Perspektive ist Soziale Arbeit ein Teil der „sozialstaatlichen Daseinsvorsorge“ (Maas 1996, 18), woraus sich für die unterschiedlichen Sozialleistungsbereiche konkrete Aufgabenstellungen ableiten lassen. Die Erwartbarkeit von Hilfe tritt dabei generell an die Stelle individualisierter Hilfsbereitschaft (Luhmann 1973).

Dies soll an der Kinder- und Jugendhilfe verdeutlicht werden: Gemäß § 1 Abs. 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Von dieser Leitnorm ausgehend werden in § 1 Abs. 3 SGB VIII die Aufträge der Kinder- und Jugendhilfe konkretisiert: Kinder- und Jugendhilfe soll junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und ihren Beitrag dazu leisten, dass Benachteiligungen vermieden oder abgebaut werden. Kinder- und Jugendhilfe soll Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten, unterstützen und dazu beitragen, dass positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien geschaffen werden. Sie soll Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen. So weit, so gut. Damit jedoch diese Leitziele der Kinder- und Jugendhilfe nicht nur auf programmatischer Ebene bestehen, sondern in der Praxis Wirkungen für junge Menschen und ihre Familien entfalten können, müssen sie vor Ort in konkrete Angebote und Leistungen übersetzt und von der freien und öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe angeboten werden. Erst durch diese Transformation der noch sehr allgemeinen Aufträge des § 1 SGB VIII in konkrete Angebote und die damit verbundene Institutionalisierung in Organisationen wird die Kinder- und Jugendhilfe in die Lage versetzt, den an sie gerichteten sozialpolitischen Auftrag einzulösen.
Читать дальше