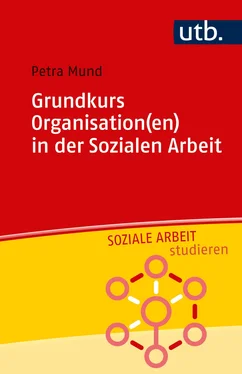Dies hat auch zur Folge, dass die Aufgaben und damit auch die unterschiedlichen Angebote der Sozialen Arbeit immer auch gesellschaftlichen Definitions- und Aushandlungsprozessen unterliegen.
Innerhalb des breiten Spektrums der Theorien der Sozialen Arbeit wird dieser spannungsreiche Zusammenhang von Sozialer Arbeit und wohlfahrtsstaatlicher Leistungsverwaltung von der Theorie der organisierten Hilfe aufgegriffen und diskutiert. Auf die in dieser theoretischen Perspektive bestehende Gefahr, Soziale Arbeit als eine „systematisch nachgeschaltete Praxis“ und „organisatorisch begrenzte Praxis“ (Sandermann / Neumann 2018, 142) zu begreifen, kann an dieser Stelle nur verwiesen werden, eine ausführliche Diskussion ist nicht möglich.
Dass (angehende) Fachkräfte der Sozialen Arbeit einen Überblick über die Vielfalt der Organisationen in der Sozialen Arbeit, ihre sozialpolitischen Aufträge und ihre unterschiedlichen Rechtsund Finanzierungsformen haben, ist also einerseits für die eigene Orientierung in und zwischen den unterschiedlichen Feldern der Sozialen Arbeit wichtig. Darüber hinaus ist dieses Wissen auch im Sinne einer stellvertretenden Orientierung und damit auch für die Interessensvertretung der AdressatInnen von Bedeutung, da diesen vielfach die Organisationsstrukturen in der Sozialen Arbeit und ihre Zusammenhänge weitgehend unbekannt sind.
Die Vermittlung eines grundsätzlichen Wissens über die Systematik der Organisationen in der Sozialen Arbeit sowie über Rechts- und Finanzierungsformen ist daher ein zentrales Ziel dieses Lehrbuchs.
Damit wären jedoch die im Einstiegsszenario aufgeworfenen Fragen nur teilweise beantwortet, wie zu Recht angemerkt werden könnte und wie es auch im Titel des Lehrbuches bereits angedeutet ist. In der Tat gibt es noch eine weitere Antwort auf die Frage, warum sich SozialarbeiterInnen mit Organisation(en) in der Sozialen Arbeit befassen sollten. So ist mit der Organisationstatsache auch verbunden, dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit in diesen Organisationen tätig werden. Rund 94% der SozialarbeiterInnen sind in einem Angestelltenverhältnis in Organisationen tätig (Wöhrle 2016). Damit geht das Handeln der Fachkräfte in der Praxis von diesen Organisationen aus. Mit Eintritt in eine der differenten Organisationen der Sozialen Arbeit, egal in welchem Handlungsfeld, werden die Fachkräfte zu einem Teil dieser Organisation. Ihr sozialarbeiterisches Handeln wird damit auch in mehrerlei Hinsicht durch die Organisation an sich und die damit verbundenen Fragestellungen beeinflusst. Was damit gemeint ist, soll im Folgenden skizziert werden.
Die Organisationen der Sozialen Arbeit sehen sich mit der Frage konfrontiert, wie sie organisiert sein sollten, damit sie ihre Ziele und Aufgaben möglichst gut und gleichzeitig auf eine für alle Beteiligten transparente und berechenbare Weise erreichen können. Dabei können der Aufbau und die Strukturen in den jeweiligen Organisationen durchaus sehr unterschiedlich sein, da die jeweiligen externen und internen Bedingungen der Organisation, ihre Größe und ihre Entstehungsgeschichte berücksichtigt werden müssen.

Vor Aufnahme ihres Studiums der Sozialen Arbeit hat die Studentin Laura ein zwölfwöchiges Praktikum im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe absolviert. Als Teil eines multidisziplinären Teams hat sie in ihrem Heimatort in einer stationären Wohngruppe mit jungen Menschen gearbeitet, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie verbleiben konnten, da ihre Erziehung und Entwicklung dort auch mit stützenden ambulanten Hilfen nicht mehr sichergestellt werden konnten. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesem Praktikum haben Laura in ihrem Wunsch, Soziale Arbeit zu studieren, bestärkt. Im Verlauf des ersten Semesters werden in einem Seminar die bisherigen Praxiserfahrungen der Studierenden thematisiert. Wie Laura waren viele der KommilitonInnen während des Vorpraktikums in der stationären Kinder- und Jugendhilfe tätig. Anhand der Berichte bemerkt Laura, dass es trotz ähnlicher Zielgruppen und Aufgaben Unterschiede bei der Gestaltung von zentralen Prozessen (=Schlüsselprozessen) wie Aufnahmeverfahren, Hilfeplanung und Elternarbeit gibt. So werden beispielsweise in der Praxisstelle von Laura, einer kleinen Organisation der Kinder- und Jugendhilfe, die neben einem großen ambulanten Bereich nur über zehn Plätze im stationären Bereich verfügt, die Anfragen zur Unterbringung eines jungen Menschen von den Fachkräften des Jugendamtes direkt an das Team der Wohngruppe gestellt. Die dort tätigen Fachkräfte koordinieren dann eigenverantwortlich den Termin mit der Familie zur Vorstellung der Wohngruppe, tauschen sich mit der Fachkraft des Jugendamtes aus und entscheiden schließlich über die mögliche Aufnahme. Bei ihrem Kommilitonen Frank, der sein Praktikum in einer großen Organisation der Kinder- und Jugendhilfe mit insgesamt 60 stationären Plätzen absolviert hat, stellen die Fachkräfte des Jugendamtes die Aufnahmeanfrage an die Leitung des stationären Bereichs. Diese übernimmt alle Absprachen mit der Familie, führt die Gespräche mit den Fachkräften des Jugendamtes und ist neben der Teamleitung und der zuständigen Psychologin maßgeblich an der Entscheidung über die mögliche Aufnahme in einer Gruppen der Organisation beteiligt.
Der Aufbau und die Strukturen müssen zu den tatsächlichen Gegebenheiten passen. Im Idealfall sind der organisatorische Aufbau und die Ablaufstrukturen, beides Teilaspekte von Organisationsgestaltung, so aufgebaut, dass sie das methodisch-professionelle Handeln der Fachkräfte in der Praxis unterstützen und nicht behindern oder gar im Widerspruch dazu stehen.

Organisationsgestaltung umfasst alle Prozesse und Maßnahmen zur systematischen Gestaltung der Strukturen, Abläufe und Prozesse in Organisationen.
Es gilt jedoch nicht nur den Einfluss zu beachten, den die Organisation durch ihren Aufbau und ihre Struktur auf das Handeln der Fachkräfte haben kann. Es müssen auch der Zusammenhang von sozialpolitischen Aufträgen und konkretem Handeln in der Sozialen Arbeit und die daraus möglicherweise resultierenden Spannungsfelder reflektiert werden. Damit ist gemeint, dass sich sozialarbeiterisches Handeln nicht nur an den Bedürfnissen und Wünschen der jeweiligen Zielgruppe orientieren kann, sondern immer auch durch die sozialpolitisch an die Organisation gerichteten Aufträge sowie die daraus abgeleiteten organisationsbezogenen Aufträge und Ziele beeinflusst wird:
„Soziale Arbeit kann nicht nur als individuell autonome professionelle Tätigkeit verstanden werden. Sie ist immer auf organisatorische, infrastrukturelle und sozialstaatliche wie auch ordnungspolitische Vorgaben angewiesen“ (Müller 2011, 144).
Hilfeerbringung in der Sozialen Arbeit steht damit in einer bipolaren Spannung, dies wird auch als das doppelte Mandat der Sozialen Arbeit bezeichnet:
„Der professionell Helfende arbeitet in der Regel in einer durch öffentliche Mittel finanzierten Institution. Diese erwartet von ihrem Mitarbeiter die Verwirklichung ihrer Zielvorstellungen, die teils ihrem Selbstverständnis, teils der öffentlichen, sozialpolitisch determinierten Beauftragung entsprechen. Gleichzeitig stehen professionell Helfende mit unverwechselbaren Menschen in Kontakt. Je nach Tätigkeitsfeld informieren, beraten, intervenieren, interagieren und erziehen sie. Der Nutzer erwartet, dass der Sozialarbeiter ihm hilft und ihn unterstützt, sein Leben zu führen. Die bipolare Spannung zwischen sozialstaatlicher Beauftragung und hilfebedürftigem Individuum lässt sich zunächst als doppeltes Mandat beschreiben. Der Helfende steht zwischen öffentlichem Auftrag und Klient“ (Maaser 2015, 97 f.).
Читать дальше