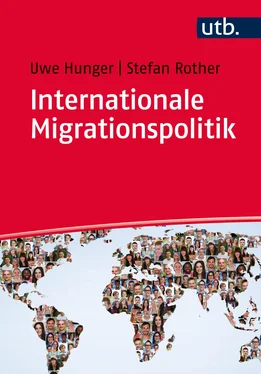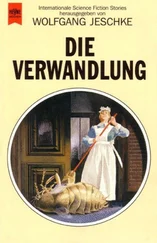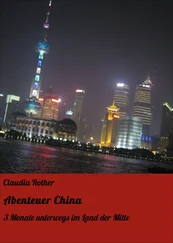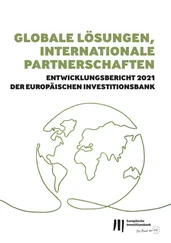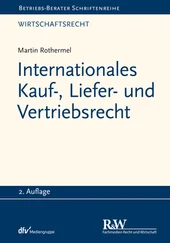UNHCR und ILO haben solche Ansätze in der Vergangenheit durchaus verfolgt (Garnier 2014). Bereits in den 1980er Jahren vereinbarten sie eine engere Zusammenarbeit, um die sozioökonomischen Rechte und Integrationsmöglichkeiten von Geflüchteten besser zu schützen (ebd.). So wurden Projekte wie etwa Unternehmensgründungs-Workshops für Frauen in Geflüchtetencamps gefördert. In den vergangenen Jahren rückte dieser Ansatz jedoch immer weiter in den Hintergrund, was Garnier auf Ressourcenknappheit, Wettbewerb zwischen den Institutionen und unterschiedliche Schwerpunktsetzungen zurückführt. Viele Staaten seien nicht einmal bereit, das Recht auf Arbeit von Geflüchteten anzuerkennen.
Das Resettlement stellt schließlich ein Instrument zur dauerhaften ‚Umsiedlung‘ von Geflüchteten dar, die nach der Flucht in einen Staat, in dem sie Schutz gesucht haben, von einem Drittstaat ausgewählt und als Geflüchtete mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht aufgenommen werden. Resettlement-Geflüchtete werden auch als Quoten- oder Kontingentflüchtlinge bezeichnet, da das Resettlement in den meisten Ländern nach einer Quotenregelung erfolgt. Resettlement-Programme können eine langfristige Lösung für größere Gruppen von Geflüchteten bieten, deren Leben oder Grundrechte im (ersten) Aufnahmeland bedroht sind. Voraussetzung für die Aufnahme sind in der Regel die Einstufung als geflüchtet nach GFK sowie bestimmte Auswahlkriterien, die je nach Staat variieren können, darunter Schutz vor physischer Gewalt, die Beschränkung der Grundrechte, aber auch die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern. Resettlement ist allerdings kein Recht, deshalb können Geflüchtete sich auch nicht darauf berufen, sondern werden durch den UNHCR, staatliche Einrichtungen oder mithilfe von NGOs ausgewählt. Staaten entscheiden dann auf Grundlage der Resettlement-Quote und der jeweiligen Aufnahmekriterien, wer einreisen darf (UNHCR 2011, S.3, 36, 243).
Die große Anzahl an Geflüchteten und Vertriebenen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges markiert den Beginn des Resettlement-Programms. In den späten 1940er Jahren konnten mehr als eine Million europäische Geflüchtete mithilfe der Vorgängerorganisation des UNHCR umgesiedelt werden, von denen die USA allein in den folgenden Jahren über 650.000 Geflüchtete aufnahm. Im Jahr 2018 war Kanada mit über 28.000 Aufnahmen das bedeutendste Resettlement-Land. Im Vergleich zu 2017 ging die Anzahl der Resettlement-Aufnahmen allerdings bedingt durch verringerte Quoten und verschärfte Sicherheits-Screenings um mehr als 10 Prozent zurück. Zu den größten Herkunftsländern der Resettlement-Geflüchteten gehören derzeit Syrien, Eritrea und die demokratische Republik Kongo (IOM 2020, S.41f.; UNHCR 2019, S.4f.).
Der UNHCR versucht angesichts zunehmender Komplexität und zurückgehender Aufnahmezahlen seit Ende der 1980er Jahre, die verschiedenen Akteure in jährlichen Konferenzen zusammenzubringen (Annual Tripartite Consultations on Resettlement) und so die Zusammenarbeit im Hinblick auf bestimmte Geflüchtetengruppen, wie zum Beispiel aus dem syrischen Bürgerkrieg Geflüchtete, zu stärken (UNHCR 2019, S.16ff.). Neben staatlichen Programmen existieren in einigen Ländern, darunter Kanada, Australien und Deutschland, auch (semi-)private Resettlement-Programme. In Kanada werden inzwischen sogar mehr als die Hälfte der Resettlement-Geflüchteten über das Private Sponsored Refugees-Programm (PSR) aufgenommen, die mehrheitlich über religiöse, Bildungs- oder Menschenrechtsorganisationen, aber auch ethnische Communities gesponsert werden. Zusätzlich hat Kanada 2013 ein privat-öffentliches Programm (Blended VISA Office Referral) geschaffen, das Resettlement-Geflüchtete mit privaten Sponsoren ‚matched‘, die gemeinsam mit dem Staat (50/50) die Unterstützungskosten für die Geflüchteten tragen (West und Plunkett 2018, S.10f.; Macklin et al. 2018, S.37f.).
Wie der Überblick gezeigt hat, ist das Thema Flucht und Asyl einer der komplexesten Bereiche internationaler Migrationspolitik. Obwohl die Notwendigkeit zur Aufnahme von internationalen Migrant*innen hier am größten ist, scheint die Bereitschaft der Nationalstaaten zur Aufnahme am wenigsten ausgeprägt. Daher ist es wichtig, gemeinsame Lösungen auf supranationaler Ebene anzustreben, so dass nicht einzelne Nationalstaaten den Hauptteil der Last tragen und andere sich aus der Verantwortung stehlen. Mit der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention ist hier im Grunde ein richtiger und wichtiger Schritt gelungen. Allerdings stellt sich immer mehr die Frage, ob der Begriff des „Flüchtlings“, wie er in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 rechtlich gefasst wurde, heute noch zeitgemäß ist. Flucht findet heute, wie wir gesehen haben, nicht mehr allein aufgrund politischer Verfolgung auf Grundlage der Ethnie, Religion, Nationalität usw. statt. Seit einigen Jahrzehnten verfestigt sich der Trend, dass Menschen eher vor Konflikten und wegen Umweltkatastrophen als vor direkter Unterdrückung und Verfolgung durch staatliche Institutionen fliehen (Zolberg und Benda 2001).
Klima- und Umweltmigration
Heute fliehen in vielen Ländern Menschen auch wegen der jahrelangen Ausbeutung ihres Landes, etwa der Bodenschätze, was dazu geführt hat, dass vielen Menschen in ländlichen Gebieten die Lebensgrundlage entzogen wurde (Ansorg 2017). Andere Migrant*innen fliehen vor Umweltkatastrophen, wie z.B. lange Dürreperioden und Verwüstungen. Insbesondere Umweltgründe werden heute noch nicht von den Kriterien der Geflüchtetendefinition erfasst. Die Vereinten Nationen begründen diesen Umstand unter anderem damit, dass der bestehende Geflüchtetenstatus nicht verwässert werden soll (Piguet et al. 2011, S.1, 17ff.; Windfuhr 2018, S.120). Dabei rechnet man damit, dass gerade die Zahlen in dieser Kategorie in den nächsten Jahrzehnten stark ansteigen werden. Die Prognosen hierzu schwanken zwischen 50 und 250 Millionen bis zum Jahr 2050 je nach Berechnungsgrundlage. Und schon heute können erste Klima-Geflüchtete ausgemacht werden, darunter aus den pazifischen Inselstaaten, deren Bevölkerung bedingt durch den steigenden Meeresspiegel und zunehmende Küstenerosion zur Umsiedlung gezwungen wird (Fritz 2010). Dieser Kampf um Begriffe und Kategorien hat für Millionen Betroffene bedeutende Folgen. Betts (2010) schlägt deshalb mit der „Survival Migration“ eine neue Kategorie vor. Diese soll alle Menschen umfassen, die ihr Herkunftsland aufgrund einer unabwendbaren existentiellen Bedrohung verlassen. Damit ließen sich laut Betts die aufgezeigten Lücken im institutionellen und normativen Rahmen für Zwangsmigration füllen, ohne dass neue Institutionen oder Konventionen erschaffen werden müssten.
Weiterführende Fragen und Literatur
Drei Fragen zum Weiterdenken
Ist die Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951, die in erster Linie aufgrund der Erfahrungen aus zwei Weltkriegen verabschiedet wurde, noch zeitgemäß? Oder sollte sie aufgrund neuer Fluchtursachen, wie Klimawandel und Hungersnöte, überarbeitet und aktualisiert werden?
Wie können die Fluchtursachen – wie religiöse, ethnische und soziale Konflikte, aber auch soziale Ungleichheiten – auf Dauer besser bekämpft werden?
Wie können die Interessen von Geflüchteten stärker in die Asyl- und Geflüchtetenpolitik der Aufnahmeländer eingebunden werden?
Drei Bücher zum Weiterlesen
UNHCR (2020): Global Trends. Forced migration in 2019. Genf.
Jährlicher Bericht des UNHCR zur weltweiten Fluchtmigration und der Situation Geflüchteter.
Gil Loescher/Elena Fiddian-Qasmiyeh/Katy Long/Nando Sigona (Hg.) (2014): The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, Oxford: Oxford University Press.
Читать дальше