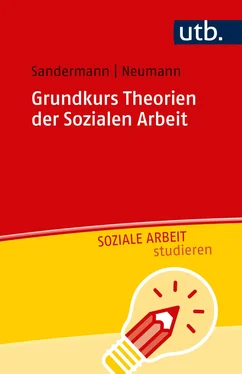Das vorliegende Buch baut auf einer langjährigen Beschäftigung mit Theorien der Sozialen Arbeit auf. Während dieser Beschäftigung war es nie unser Anspruch, selbst eine Theorie der Sozialen Arbeit zu entwerfen. Es war aber immer ein Anspruch, Theorien der Sozialen Arbeit – jede für sich genommen und im Vergleich zueinander – durch die Beschäftigung mit ihnen besser zu verstehen. Was dabei in hohem Maße zur Entwicklung unserer eigenen Verstehensperspektive, der wir im vorliegenden Buch folgen, beigetragen hat, waren Gespräche zum Thema mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen. Gedankt sei in diesem Zusammenhang insbesondere Petra Bauer, Georg Cleppien, Kai Dierkes, Bernd Dollinger, Gabriel Eichsteller, Nicole Hekel, Reinhard Hörster, Michael-Sebastian Honig, Bettina Hünersdorf, Onno Husen, Kerstin Jergus, Magdalena Joos, Fabian Kessl, Stefan Köngeter, Randolf Körzel, Martina Lütke-Harmann, Veronika Magyar-Haas, Sebastian Manhart, Marcel Meier Kressig, Johanna Mierendorff, Richard Münchmeier, Christian Niemeyer, Mareike Patschke, Hans Thiersch, Christiane Thompson, Maren Zeller sowie Ulrike Urban-Stahl, die zugleich Herausgeberin dieser Einführungsreihe ist und in diesem Zuge eine besonders unterstützende Rolle für das Zustandekommen des vorliegenden Buches gespielt hat. Darüber hinaus möchten wir den vielen Studierenden und denjenigen Promovierenden danken, mit denen wir im Laufe der letzten Jahre immer wieder zum Thema diskutieren konnten.
Neben Gesprächen und Diskussionen haben gerade auch die Handlungserfahrungen, die wir selbst als „Praktiker“ gemacht haben, zur schrittweisen Erarbeitung unserer Verständnisperspektive beigetragen. Wie bei vielen Kolleginnen und Kollegen war „die Praxis der Sozialen Arbeit“ in unserem Fall vornehmlich die Kinder- und Jugendhilfe. Gerade hier drängte sich uns beiden unabhängig voneinander immer wieder der Eindruck auf, dass eine Perspektive produktiver Distanz zu vorfindbaren Theorien der Sozialen Arbeit dabei helfen kann, die Art und Weise, in der Theorien der Sozialen Arbeit „ihre“ Praxis konstruieren, besser begreifen zu können.
Wir wünschen den LeserInnen der vorliegenden Einführung, dass die hier eröffnete Verstehensperspektive sie darin unterstützen möge, einen wissensbasierten Überblick zu Theorien der Sozialen Arbeit zu entwickeln oder auch zu vertiefen. Wo sich bei der Lektüre Kritik an unserem Blick regt, sind wir dankbar für Rückmeldungen. Denn – so unsere Überzeugung – Theorien lassen sich am besten im Dialog entwickeln. Theorien über Theorien bilden dabei keine Ausnahme.
1 Was sind Theorien der Sozialen Arbeit?

Das Ziel dieses Kapitels ist es zu klären, was Theorien der Sozialen Arbeit sind. Dafür ist es zunächst wichtig zu verdeutlichen, inwieweit Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit logisch eng miteinander zusammenhängen. Im ersten Unterkapitel 1.1werden wir der Ausgangsthese folgen, dass sich Theorien immer auf etwas beziehen, was sie als „real“ ansehen. Umgekehrt gilt damit zugleich, dass die Beschäftigung mit Theorie immer auch eine Auseinandersetzung darüber einschließt, worauf sich Theorie bezieht. Im Falle der Sozialen Arbeit ist dieser Bezugspunkt üblicherweise „die Praxis“. Welchen Auftrag Theorien genau haben, darüber gibt es allerdings – gerade in den Sozial- und Geisteswissenschaften – nicht nur Konsens, sondern auch entscheidende Kontroversen und Differenzen. Dies gilt auch im Bereich von Theorien, welche das Ziel haben, Wissen über die Soziale Arbeit zu generieren. Strittig ist dabei vor allem, was als „wertvolles“ Theoriewissen zur Sozialen Arbeit anzusehen ist. Eine entscheidende Dissenslinie verläuft z. B. zwischen Positionen, die Theorien in der Pflicht sehen, normatives Handlungswissen bereitzustellen, und Positionen, die diese Möglichkeit bestreiten oder sie zumindest der Aufgabe von Theorien unterordnen, reflexives, analytisches Wissen zu produzieren. Weitgehende Einigkeit besteht jedoch darin, dass sich theoretische Erkenntnisse über die Praxis, die durch Theorien der Sozialen Arbeit generiert werden, nicht einfach „in die Praxis“ übertragen oder für eine Veränderung von Praxis „benutzen“ lassen. Warum das so ist, werden wir in Kapitel 1.2erläutern. In Kapitel 1.3werden wir noch einmal zusammenfassen, warum es wertvoll ist, sich innerhalb des Studiums mit Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit zu beschäftigen – zumal man sich reflektierterweise gar nicht für nur eines von beidem entscheiden kann. Abschließend werden wir noch einmal verdeutlichen, welchen theoretischen Blick dieses Buch auf Theorien der Sozialen Arbeit richtet.
1.1 Zum konstitutiven Zusammenhang von Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit

Theorie interessiert mich nicht, denn ich will ja in die Praxis!“ Diesen Satz hört man von Studierenden der Sozialen Arbeit immer wieder. Nachfolgend verdeutlichen wir, warum es Sinn macht, diesem Satz mit äußerstem Misstrauen zu begegnen.
Aus dem Alltagsverständnis, dass es sich bei Theorie und Praxis um zwei unterschiedliche Dinge handelt, wird gelegentlich geschlussfolgert, dass Theorie und Praxis eigentlich nichts oder jedenfalls nicht unmittelbar etwas miteinander zu tun haben (können). Wir werden im Folgenden zeigen, dass sich zwar die erste Annahme („Theorie und Praxis sind etwas Unterschiedliches“) durchaus gut begründen lässt. Das heißt jedoch gerade nicht, dass Theorie und Praxis zwei völlig unterschiedliche oder gar unvereinbare Sachverhalte sind.
Aber der Reihe nach: Zunächst einmal macht es tatsächlich einen Unterschied, ob man über Theorie spricht oder über Praxis. Auch deswegen gibt es z.B. unterschiedliche Bände innerhalb der vorliegenden Reihe „Soziale Arbeit studieren“, von denen nur einer explizit das Thema „Theorien der Sozialen Arbeit“ behandelt. Man kann also durchaus davon ausgehen, dass sich die Unterscheidung von Theorie und Praxis in der Sozialen Arbeit eingebürgert hat und ihr damit auch eine gewisse Sinnhaftigkeit zukommt.
Diese Sinnhaftigkeit ist bereits daran zu erkennen, dass wohl kaum jemand spontan bestreiten würde, dass beides zu existieren scheint: Es gibt einerseits „Theorie der Sozialen Arbeit“ und andererseits „Praxis der Sozialen Arbeit“, sonst würde man nicht ständig über beides sprechen. Die Aussage, dass es Praxis der Sozialen Arbeit gibt, ist jedoch keineswegs so selbstverständlich, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Sie hat bereits mit einer Besonderheit zu tun, auf die wir im Verlauf dieses Buches verschiedentlich zu sprechen kommen werden.
Um ein erstes Verständnis für diese Besonderheit zu entwickeln, kann ein Blick auf andere Fachdisziplinen hilfreich sein. Hierzu ein Gedankenexperiment:

Stellen Sie sich vor, Sie studierten ein anderes Fach als „Soziale Arbeit“, z.B. Philosophie, Soziologie oder auch Physik. Was eine „Praxis der Philosophie“ sein könnte, leuchtet Ihnen vielleicht noch relativ spontan ein. Wie sieht es aber mit Ihren spontanen Assoziationen zu so etwas wie einer „Praxis der Soziologie“ oder einer „Praxis der Physik“ aus? Eine Vorstellung davon ist zwar keineswegs unmöglich. Sich ein konkretes Bild davon zu machen, erscheint aber auf den ersten Blick voraussetzungsreicher zu sein als eine Vorstellung von der „Praxis der Sozialen Arbeit“. Eine solche Vorstellung wird jede/r Leserin dieses Bandes spontan entwickeln können – wenngleich sie sich, wie wir später zeigen werden, auf den zweiten Blick nicht notwendigerweise als tragfähig herausstellen muss. Trotzdem gehen die meisten Menschen davon aus: „Natürlich, eine Praxis der Sozialen Arbeit, das gibt es!“ Aber eine Praxis der Physik?
Читать дальше