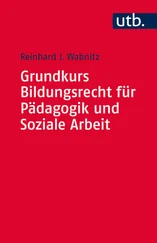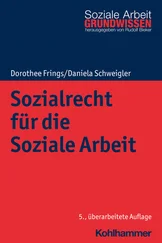Etwa ab dem 15–18. Lebensmonat setzt das vierte Stadium des Selbstempfindens ein, welches Stern als das verbale bzw. konzeptuelle Selbst bezeichnet. Das Kind wird sich seiner selbst als „ich“ bewusst. Bis zu dieser Zeit ist das sog. Playmate-Verhalten zu beobachten. Die Kinder lächeln oder spielen mit dem Spiegelbild wie mit einem Spielpartner, identifizieren es aber nicht als ihr eigenes Abbild. Nun erkennen Kinder ihr eigenes Spiegelbild.
Auch motivational geschieht in diesem neuen Stadium des Selbstempfindens eine Veränderung: Die Kinder bekommen ein Gefühl für ihre eigene Leistung. In einem Experiment wurde deutlich, dass Kinder ab dem Zeitpunkt, an dem sie sich selbst im Spiegel erkennen können, nicht mehr gelassen darauf reagieren, ob sie oder jemand anderes den letzten Stein auf einen selbst gebauten Turm legen. Sie geben deutlich zu erkennen, die Erfahrung des Selbst-fertiggestellt-Habens machen zu wollen (Bischof-Köhler 2011). Diese Phase geht mit einer zunehmenden Fähigkeit zu symbolisieren, d.h. in Als-ob-Möglichkeiten zu denken, einher. Es ist eine Phase, in der man Kinder wie selbstverständlich mit einem Auto am Ohr durchs Zimmer streifen sieht – sie „telefonieren“ dann, bzw. tun so, als ob.
„In der Ausgestaltung von Als-ob-Situationen – ich tue so, als wenn ich einkaufen gehe, indem ich Mamas Schlüssel, ihre Schuhe und eine Plastiktüte als Handtasche nehme – macht sich das Kind eine weitere Realität verfügbar. Mit symbolischen Gesten und Handlungen setzt es Erfahrungen und Ereignisse in Szene, die von realen Ereignissen und Gegenständen entkoppelt sind. Das Spiel ist geprägt von Intensität, Ernsthaftigkeit, Freude, Kreativität und Konzentration; es folgt einem inneren ‚Faden‘ und führt zu Zufriedenheit und Sättigung“ (Rass 2011, 91).
Die Fähigkeit zur Symbolisierung ist eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung späterer Verbalisierungs- und Abstraktionsfähigkeiten und auch dafür, Emotionen in Sprache zu übersetzen und nicht unmittelbar auszuagieren. Jugendliche mit dissozialen Störungen – eine häufige Klientel von SozialarbeiterInnen – sind oftmals genau in dieser Fähigkeit beeinträchtigt; ihnen fehlt die Möglichkeit, ihre Wut zu verbalisieren, sodass sie sie in gewalttätigen Handlungen ausdrücken müssen.
2.5.2 Kognitionen, Emotionen und die Fähigkeit zur Selbstregulation
Jean Piaget (1896–1980) gilt als einer der wichtigsten Entwicklungspsychologen, der sich mit der geistigen Entwicklung von Säuglingen und Kindern beschäftigte. Er verstand diese geistige Entwicklung als Prozess der aktiven Konstruktion von Wissen in der Interaktion des Individuums mit der Umwelt. Das Kind bezeichnete Piaget als einen von einer inneren Neugier getriebenen Wissenschaftler, der aktiv seine Umwelt erkunde (Piaget 2003, Sodian 2012). Dabei beschrieb er den Erkenntnisprozess im Wechselspiel von zwei komplementären Mechanismen. Den einen nannte Piaget Assimilation. Assimilation geschehe immer dann, wenn etwas Neues in bestehende mentale Strukturen integriert werden könne. Dieser reiche aber allein nicht aus, um sich den Lernzuwachs von Kindern zu erklären:
„Wenn nur Assimilation an der Entwicklung beteiligt wäre, gäbe es keine Variationen in der Struktur des Kindes. Infolgedessen würde es keine neuen Inhalte erwerben und sich nicht weiterentwickeln“ (Piaget 2003, 55).
Den anderen und ergänzenden Mechanismus bezeichnete Piaget als Akkomodation. Hierbei müssen sich die mentalen Strukturen an die Umweltanforderungen anpassen und entwickeln sich auf diese Weise weiter. Das Wechselspiel dieser beiden Mechanismen soll an folgendem Beispiel illustriert werden:
 Ein anderthalbjähriges Kind hat herausgefunden, dass ein Teller, wenn es ihn auf den Boden wirft, zerbricht. Wenn es dann eine Tasse herunterwirft, lernt es, dass auch Tassen zerbrechen und ordnet dies seinem vorhandenen Wahrnehmungsschema zu, dass Gegenstände, wenn man sie herunterwirft, kaputt gehen. So erklärt sich der Mechanismus der Assimilation. Die bestehende mentale Struktur des Kindes beinhaltet nun die Überzeugung, dass Gegenstände, die man hinunterwirft, kaputt gehen. Nun stellt das Kind aber fest, dass z.B. ein Plastikteller oder ein Plastikauto heil bleibt, obwohl man sie herunterwirft. Das heißt, das Kind verändert durch den Mechanismus der Akkomodation seine mentalen Strukturen von „alle Gegenstände gehen kaputt, wenn ich sie runterwerfe“ in „manche Gegenstände, die ich herunterwerfe, gehen kaputt, andere nicht“.
Ein anderthalbjähriges Kind hat herausgefunden, dass ein Teller, wenn es ihn auf den Boden wirft, zerbricht. Wenn es dann eine Tasse herunterwirft, lernt es, dass auch Tassen zerbrechen und ordnet dies seinem vorhandenen Wahrnehmungsschema zu, dass Gegenstände, wenn man sie herunterwirft, kaputt gehen. So erklärt sich der Mechanismus der Assimilation. Die bestehende mentale Struktur des Kindes beinhaltet nun die Überzeugung, dass Gegenstände, die man hinunterwirft, kaputt gehen. Nun stellt das Kind aber fest, dass z.B. ein Plastikteller oder ein Plastikauto heil bleibt, obwohl man sie herunterwirft. Das heißt, das Kind verändert durch den Mechanismus der Akkomodation seine mentalen Strukturen von „alle Gegenstände gehen kaputt, wenn ich sie runterwerfe“ in „manche Gegenstände, die ich herunterwerfe, gehen kaputt, andere nicht“.
Piaget umschrieb die ersten zwei Lebensjahre als sensumotorisches Stadium, in dem die kognitiven Grundlagen für die sensorischen und motorischen Handlungen – die sensumotorischen Schemata – gelegt werden. Dazu zählen z.B. das Saugschema und die Exploration mit dem Mund. Jean Piaget fand auch heraus, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter – er schätzte es bei acht Monaten – keine Objektpermanenz haben. Sie gehen also davon aus, dass ein Gegenstand – z.B. ein Ball –, der aus ihrem Blickfeld verschwindet, dann auch nicht mehr existiert. Nach heutigen Erkenntnissen weiß man allerdings, dass Piaget die kognitiven Fähigkeiten jüngerer Kinder deutlich unterschätzte, dass sich die Fähigkeit zur Objektpermanenz deutlich früher einstellt und prozesshaft verläuft, als Piaget dieses angenommen hatte (Sodian 2012).
Bereits im Säuglingsalter können kulturübergreifend sieben bis zehn Basisemotionen beobachtet werden. Dazu zählen Freude, Angst, Trauer, Wut, Ekel, Verachtung, Überraschung, Interesse, Scham und Schuld (Izard 1999, Dornes 2012). Im Film „Alles steht Kopf“, der vom Emotionsforscher Dacher Keltner mitentwickelt wurde, wird sichtbar, wie sehr Gefühle die Weltwahrnehmung dominieren und bei gleichzeitigem Auftreten auch verwirren können. Emotionen sind immer von physiologischen Reaktionen und kognitiven Bewertungen begleitet, wobei manchmal die Emotion der Kognition vorausgeht und manchmal umgekehrt die Kognition die Emotion bestimmt (Myers 2014). Auf dieser Basis arbeitet beispielsweise die kognitive Verhaltenstherapie mit depressiven Menschen, in dem sie mit ihren Klienten positive Umdeutungen von chronisch als negativ erlebten Situationen übt (s. Kapitel 6.3). Säuglinge und Kleinkinder sind noch nicht in der Lage, negative Emotionen kognitiv zu beeinflussen, und sind ihren Bedürfnissen und Gefühlen daher – anders als Erwachsene – ausgeliefert. Sie brauchen in der Regel Unterstützung bei ihrer Emotions- und Spannungsregulation.
Besonders evident wird dies bei sogenannten Trotzanfällen. Trotzanfälle, die in der Regel im dritten und vierten Lebensjahr auftreten, resultieren entwicklungspsychologisch betrachtet aus einer faktischen Diskrepanz zwischen dem wachsenden Autonomieanspruch des Kindes auf der einen und seinen im Vergleich dazu noch nicht ausreichenden Fähigkeiten auf der anderen Seite. Das Kind kann weder alles, noch darf es alles. Infolgedessen ist es häufig frustriert und drückt in Trotzanfällen seine Wut und seinen Ärger aus. Ebenso kann Trotzverhalten entstehen, wenn das Kind sich schämt und diese Scham nicht aushalten kann (Wurmser 1998). Trotzanfälle können aber auch dann auftreten, wenn sich das Kind gar nicht in Interaktion befindet. Beispielsweise kann es darum gehen, dass ein Kind sich zwischen zwei Spielzeugen oder Aktivitäten nicht entscheiden kann und der entstehende Motivkonflikt zu einer totalen Handlungsblockade führt.
„Mit dem Ich als erlebtem Zentrum des Wollens und der Möglichkeit, sich Handlungsalternativen vorzustellen, entsteht also die Notwendigkeit, interne Motivkonflikte zu managen. Das Kind muss also als nächstes lernen, dass Selbst-Wollen-Können nicht bedeutet, alles gleichzeitig wollen zu können“ (Bischof-Köhler 2011, 160).
Читать дальше
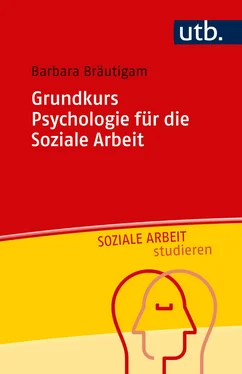
 Ein anderthalbjähriges Kind hat herausgefunden, dass ein Teller, wenn es ihn auf den Boden wirft, zerbricht. Wenn es dann eine Tasse herunterwirft, lernt es, dass auch Tassen zerbrechen und ordnet dies seinem vorhandenen Wahrnehmungsschema zu, dass Gegenstände, wenn man sie herunterwirft, kaputt gehen. So erklärt sich der Mechanismus der Assimilation. Die bestehende mentale Struktur des Kindes beinhaltet nun die Überzeugung, dass Gegenstände, die man hinunterwirft, kaputt gehen. Nun stellt das Kind aber fest, dass z.B. ein Plastikteller oder ein Plastikauto heil bleibt, obwohl man sie herunterwirft. Das heißt, das Kind verändert durch den Mechanismus der Akkomodation seine mentalen Strukturen von „alle Gegenstände gehen kaputt, wenn ich sie runterwerfe“ in „manche Gegenstände, die ich herunterwerfe, gehen kaputt, andere nicht“.
Ein anderthalbjähriges Kind hat herausgefunden, dass ein Teller, wenn es ihn auf den Boden wirft, zerbricht. Wenn es dann eine Tasse herunterwirft, lernt es, dass auch Tassen zerbrechen und ordnet dies seinem vorhandenen Wahrnehmungsschema zu, dass Gegenstände, wenn man sie herunterwirft, kaputt gehen. So erklärt sich der Mechanismus der Assimilation. Die bestehende mentale Struktur des Kindes beinhaltet nun die Überzeugung, dass Gegenstände, die man hinunterwirft, kaputt gehen. Nun stellt das Kind aber fest, dass z.B. ein Plastikteller oder ein Plastikauto heil bleibt, obwohl man sie herunterwirft. Das heißt, das Kind verändert durch den Mechanismus der Akkomodation seine mentalen Strukturen von „alle Gegenstände gehen kaputt, wenn ich sie runterwerfe“ in „manche Gegenstände, die ich herunterwerfe, gehen kaputt, andere nicht“.