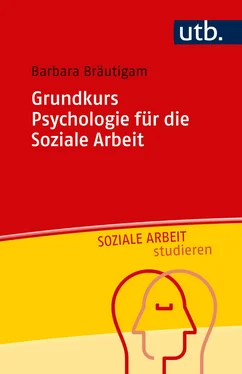Auch das Verhalten der Mutter kann Schädigungen für das Kind verursachen. So schaden Nikotin, Alkohol sowie der Konsum anderer Drogen – mit Ausnahme von Koffein – der Entwicklung des Embryos und späteren Fötus. Es sei an den eingangs beschriebenen Fall von Lisa erinnert, bei der der Drogenkonsum der Mutter mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Auslöser der Frühgeburt gewesen ist. Weitere Folgeschäden können Missbildungen und/oder Verhaltensstörungen sein. Die Zahl der jährlich in Deutschland mit alkoholbedingten Schädigungen auf die Welt gebrachten Kinder liegt in den 2010er Jahren bei etwa 10.000, ca. 2000 Babys erfüllen das Vollbild des „fetalen Alkoholsyndroms“. Dieses kann sich in drei Bereichen entfalten: in körperlichen Fehlbildungen, Wachstumsstörungen und Schädigungen des zentralen Nervensystems. Diese Gruppe bildet ein nicht zu vernachlässigendes Klientel von SozialarbeiterInnen (Pfinder/Feldmann 2011, ter Horst 2010).
SozialarbeiterInnen arbeiten nicht nur mit den hiervon betroffenen Kindern, sondern auch mit ihren Eltern, und insbesondere mit ihren Müttern. Sie haben die Aufgabe, in der Arbeit mit drogen- und alkoholabhängigen potenziellen und schwangeren Müttern präventiv tätig zu sein und diese aufzuklären. Wenn die Kinder geboren wurden, sind sie weiter unterstützend tätig in der Elternarbeit.
Unterschätzt werden nach wie vor die Folgen einer unerkannten und nicht behandelten postpartalen Depression. Etwa 10–15% (Bühring 2012) der Mütter erleiden eine postpartale Depression, die sich von dem zwei- bis fünftägigen „Babyblues“ unmittelbar nach der Geburt in ihrer Länge und ihrem Ausmaß unterscheidet. Erschwerend für die Erkennung und Behandlung dieser Erkrankung kommt hinzu, dass der gesellschaftliche Druck auf die Frauen, jetzt glücklich mit ihrem neugeborenen Kind sein zu müssen, nach wie vor enorm hoch ist und die Scham, diesen Erwartungen nicht entsprechen zu können, umso höher. Aus sozialarbeiterischer Sicht ist insbesondere darauf zu achten, die postpartale Depression als solche zu enttabuisieren, über Behandlungsmöglichkeiten zu informieren, Betroffene ggf. an psychiatrische oder psychotherapeutische Fachkräfte weiter zu vermitteln sowie die sozialen Netzwerke der Betroffenen zu aktivieren, um diese auch informell zu unterstützen. Insbesondere aufsuchende Hilfeformen sind ausgesprochen geeignet, die Rate unerkannter und unbehandelter postpartaler Depressionen zu senken (Hübner-Liebermann et al. 2012). Die postpartale Psychose, eine Erkrankung, bei der die betroffene Frau unter extremen Angst-, Wahnvorstellungen oder Halluzinationen leidet, ist eher selten und betrifft 0,1–0,2% der Mütter. Sie bedürfen in der Regel einer sofortigen stationären psychiatrischen Behandlung, wobei idealerweise Fachkräfte der Sozialen Arbeit die Zusammenarbeit verschiedener Professionen koordinieren sollten.
2.5 Entwicklung in der Säuglings-und Kleinkindzeit
„Für Joey sind fast alle Begegnungen mit der Welt dramatisch und vom Gefühl bestimmt. Elemente und Wesen dieser dramatischen Zusammentreffen sind für uns Erwachsene nicht offensichtlich. Von allen Dingen im Zimmer erregt der Sonnenschein an der Wand Joeys Aufmerksamkeit am meisten und hält ihn in Bann. Die Helligkeit und Intensität faszinieren ihn. Im Alter von sechs Wochen ist seine Sehfähigkeit schon recht gut entwickelt, wenn auch zur Perfektion noch einiges fehlt. Er erkennt bereits verschiedene Farben, Formen und Intensitätsgrade. Von Geburt an hat er starke Vorlieben für bestimmte Dinge, die er ansehen möchte, für Dinge, die ihm gefallen. An erster Stelle steht dabei die Intensität einer Wahrnehmung […]“ (Stern/Bruschweiler-Stern 2004, 24).
Dieses Zitat stammt aus dem fiktiven „Tagebuch eines Babys“ des britischen Entwicklungspsychologen Daniel Stern, bei dem höchst eindrücklich die Wahrnehmung eines Sonnenstrahls durch einen Säugling beschrieben wird. Bereits Neugeborene verfügen über ein differenziertes Wahrnehmungsvermögen: Sie schmecken und unterscheiden von Anfang an zwischen „süß“, „sauer“ und „bitter“. Nach wenigen Tagen erkennen sie ihre Mutter am Geruch. Sie hören bereits seit dem sechsten Schwangerschaftsmonat und orientieren sich als Neugeborene in Richtung einer Schallquelle. Sie sind in der Lage, Objekte, Muster, Figuren oder Formen zu erkennen, wenn sie sie auch noch nicht mit den Augen fixieren können, und sie unterscheiden Farbtöne und Helligkeitsabstufungen. Im Unterschied zu Sigmund Freud, der den Säugling noch als passives und einzig und allein an seiner Lustbefriedigung orientiertes Wesen ansah, hat der Entwicklungspsychologe Martin Dornes (1993) das Bild des kompetenten und an Interaktion interessierten Säuglings geprägt. Im Folgenden werden zum einen die Entwicklung des Selbst, und zum anderen die frühe Entwicklung kognitiver, emotionaler und selbstregulatorischer Prozesse beschrieben.
2.5.1 Die Entwicklung des Selbst
Daniel Stern (1979)schildert die Entwicklung des Selbstempfindens in vier Stadien. Das erste Stadium wird durch ein sogenanntes unreflektiertes Selbstempfinden gekennzeichnet; das Neugeborene ist ganz mit sich und seinen vegetativen Prozessen beschäftigt, von denen es beherrscht und manchmal auch gequält wird. Stern hat für dieses Stadium den schönen Begriff des auftauchenden Selbst geprägt; der dritte Lebensmonat, der auch den Übergang von der Neugeborenen- zur Säuglingszeit darstellt, ist oft ein Zeitpunkt, an dem viele Kinder erst „richtig“auf die Welt kommen.
Ab dem dritten Monat erfolgt laut Stern die Bildung eines Kernselbst. Das Kind spürt, dass es von der Mutter körperlich getrennt ist, und es existiert ein primär körperliches Selbstempfinden. Ab diesem Zeitpunkt werden bereits zwei entgegengesetzte Grundbedürfnisse erkennbar, die den Menschen ein Leben lang begleiten werden: das Bedürfnis nach Bindung und das Bedürfnis nach Exploration und Autonomie. Lichtenberg (1991) spricht von fünf Motivationssystemen, die er bereits dem Säuglingsalter zuschrieb. Dazu gehören die Notwendigkeit biologische Bedürfnisse wie Essen und Schlafen zu erfüllen, das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung, das Bedürfnis nach Rückzug, wenn unangenehme Dinge passieren, und das Bedürfnis nach Sinnlichkeit und Sexualität.
Ungefähr mit Beginn des siebten Lebensmonats wird, so Stern, das Stadium des subjektiven Selbst erreicht. Dieses bedeutet, dass das Kind ab diesem Zeitpunkt die zentrale Erfahrung von Intersubjektivität macht – Erlebnisse und Gefühle können mit anderen geteilt werden. Interessanterweise geht dieses Stadium mit einem bedeutsamen Schritt in der motorischen Entwicklung einher: Etwa ab diesem Zeitpunkt können sich die meisten Kinder auf irgendeine Weise von ihren Bezugspersonen wegbewegen. Charakteristisch ist ein eifriges Wegrobben, das von einem in regelmäßigen Abständen den Kopf in Richtung der Bezugsperson Wenden begleitet wird – nach dem Motto: „Bist Du noch da? Na dann ist gut, dann kann ich weiter. “
In dieser Sequenz bildet sich das Grundkonzept bzw. die Grundspannung komplementärer menschlicher Bedürfnisse ab, die bereits bei der Beschreibung des Bindungsbegriffs (s. Kapitel 2.3.1) benannt wurde: Es geht um die Befriedigung des Explorationsbedürfnisses – die Suche nach Veränderung – und um die des Bindungsbedürfnisses – der Wunsch nach einer sicheren Rückzugsmöglichkeit. Ungefähr zur selben Zeit setzt das sogenannte „Fremdeln“ ein, das sich vor allem in der Abwendung des Blicks und lauten Unmutsäußerungen manifestiert, wenn eine sich dem Kind nicht ganz so vertraute Person plötzlich nähert. Dieses Phänomen tritt auf, wenn sich bereits eine Bindung an eine Bezugsperson etabliert hat, also Vertrauen entstanden ist. Unter funktionalen Gesichtspunkten erklärt sich das Fremdeln aus der neu entstandenen Fähigkeit zu eigener Fortbewegung. Das Kind kann sich selbst wegbewegen und sich vor Fremden und nicht fürsorgemotivierten Personen quasi schützen (Bischof-Köhler 2011).
Читать дальше