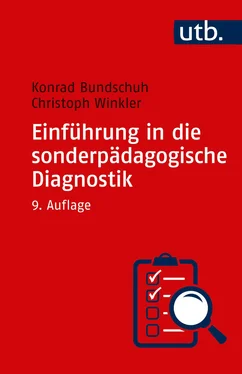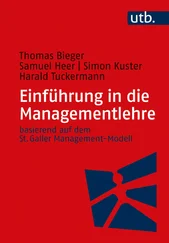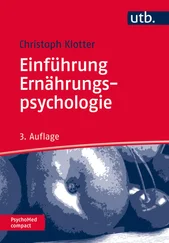1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Wenn auch die Gruppe der Schüler mit Lernbehinderungen (Förderbedarf Lernen) und / oder Verhaltensstörungen (Förderbedarf Verhalten, soziale und emotionale Entwicklung) den größten Bereich der mit sonderpädagogisch-diagnostischen Maßnahmen zu Konfrontierenden umfasst, geht es nicht allein und primär um diese Gruppe, vielmehr steht die Frage der Hilfe, Unterstützung und Förderung aller Kinder mit einem besonderen Förder- und / oder Lerntherapiebedarf im Vordergrund der Überlegungen.
Traditionell gesehen hat es die sonderpädagogische Diagnostik mit allen Personen zu tun, mit denen sich die allgemeine Sonderpädagogik beschäftigt, also mit allen „Formen der Beeinträchtigung“, wie sie von Bach beschrieben wurden (1995, 8 f.). Wenn man vom Schweregrad ausgeht, müsste man die teilweise nicht oder kaum objektiv feststellbare Form der „Gefährdung“ (Auffälligkeit) sowie das Bedrohtsein von Behinderung an den Anfang stellen und als gravierende Form die Behinderung nennen.
Bach definiert „Beeinträchtigung“ als „die Erschwerung“ der Personalisation und Sozialisation eines Menschen. Sie ist durch besondere Herausforderungen an Erziehung und Förderung bei Erziehungsprozessen in Familie, Schulen, ggf. auch in Heimen gekennzeichnet.
Liegt noch keine objektive Feststellung vor, wird erst von bloßer Auffälligkeit gesprochen. Der Übergang zwischen regelhaften und erschwerenden, unregelhaften Gegebenheiten des Erziehungsprozesses ist fließend, Beginn und Ausmaß der einzelnen Beeinträchtigungen sind nicht präzise zu fixieren. Beeinträchtigungen müssen unter dem Aspekt subjektiver, sozialer, situativer und temporärer Relativität gesehen werden.
Im diagnostischen Bereich wird es notwendig sein, die Probleme eines Kindes sowie die behindernden Bedingungen im Umfeld in differenzierter Form zu erkennen und zu analysieren. Traditionell gesehen wurde zwischen einzelnen Formen von Beeinträchtigungen unterschieden, demgemäß zwischen Schweregraden von Beeinträchtigungen.
Kinder mit Behinderungen waren auf der Basis der Überlegungen des Deutschen Bildungsrates der 1970er Jahre dadurch gekennzeichnet, dass ihre individuellen Beeinträchtigungen, „umfänglich“, (d. h., mehrere Lernbereiche sind betroffen), „schwer“ (d. h., graduell mehr als ein Fünftel unter dem Regelbereich liegend) und „langfristig“ (d. h. eine Angleichung an den Regelbereich ist voraussichtlich innerhalb von zwei Jahren nicht möglich) waren. Die Frage wäre natürlich, ob z. B. alle „Lernbehinderten“ „behindert“ waren im Sinne dieser Definition.
Heute beschäftigt sich die Diagnostik im Arbeitsfeld Sonder- und Heilpädagogik vor allem mit der Problemsituation des einzelnen Kindes im Kontext Beeinflussung durch das Umfeld, speziell mit der Frage nach dem individuellen Förderbedarf – im Unterschied zu Klassifizierungen und Zuordnungen zu „Schweregraden von Beeinträchtigungen“.
Die sonderpädagogische Diagnostik befasst sich auch mit Kindern mit Lern- und Verhaltensstörungen bzw. -auffälligkeiten. Bach definiert Störungen als „individuale Beeinträchtigungen, die partiell (d. h. nur einen Lernbereich betreffend), oder weniger schwer (d. h. graduell weniger als ein Fünftel vom Regelbereich abweichend) oder kurzfristig (d. h. voraussichtlich in bis zu zwei Jahren dem Regelbereich anzugleichen) sind“ (1995, 9 f.). Auch hierbei geht es in erster Linie – wiederum traditionell betrachtet – um Zuordnungen.
Bei Kindern mit Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten kommt der sonderpädagogischen Diagnostik primär die Aufgabe zu, Störungen hinsichtlich ihrer Ätiologie, vor allem im Kontext behindernder Bedingungen zu analysieren, das Kind zu stützen und eine für das Kind positive Veränderung im Umfeld zu bewirken.
Die nächste Personengruppe, mit der sonderpädagogische Diagnostik konfrontiert wird, sind Kinder und Jugendliche mit Gefährdungen. Gefährdungen bezeichnet Bach als
„Beeinträchtigungen, die in der Form somatischer, ökonomischer oder sozialer Lernbedingungen mit erschwerendem Charakter Störungen oder Behinderungen zu bewirken oder zu verstärken angetan sind“ (1995, 10).
Im Zusammenhang mit Gefährdungen sind vor allem „Prävention“und „Prophylaxe“ von Bedeutung (Bundschuh 2009, 26–30). So ist es dringend notwendig, dass im vorschulischen Stadium (Kindergarten, Vorschule, Schulkindergarten oder schon früher) Gefährdungen erkannt und aufgrund von Verhaltensbeobachtungen und des Einbezugs von Entwicklungsskalen Möglichkeiten kompensatorischer Erziehung und Förderung im Hinblick etwa auf Lernreize und soziales Verhalten entworfen und realisiert werden.
Schließlich ist es auch notwendig, „Sozialrückständigkeiten“ zu diagnostizieren, d. h. Beeinträchtigungen der Gesellschaft, die in der Form von Einstellungen, Verhaltensweisen, Gepflogenheiten, materiellen Bedingungen und gesetzlichen Regelungen, Gefährdungen, Störungen und Behinderungen teils verursachen, teils steigern und teils ignorieren und damit mögliche Hilfestellungen verhindern (Bach 1995, 19). Die „Diagnose behindernder Bedingungen“ (Bundschuh 2019, 101–105) wird seit einigen Jahren verstärkt gesehen und erforscht.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die angeführten Formen der Beeinträchtigung häufig in Verbindung unterschiedlicher Kombinationen mit wechselseitigem Verstärkungscharakter auftreten und dass zwischen Behinderungen und Störungen, zwischen Störungen und Gefährdungen und zwischen Gefährdungen und Sozialrückständigkeiten fließende Übergänge bestehen können.
Aufgabe des vorliegenden Buches ist es nicht primär, über eine Grundlageninformation hinausgehend, Probleme und Kritik der aufgezeigten „Beeinträchtigungen“ mit der Vielfalt wechselseitiger Bezüge und Verflechtungen zu diskutieren und zu erörtern. Hierzu sei auf kritische Literatur im Bereich Sonderpädagogik verwiesen, die sich mit Detailfragen bezüglich Beeinträchtigungen, Störungen und Behinderungen unter dem Aspekt historischer und gegenwärtiger Problemstellungen auseinandersetzt.
Resümierend ist hervorzuheben, dass es nicht nur zum Gegenstandsbereich sonderpädagogischer Diagnostik gehören kann, besondere Strategien der Diagnose in Anlehnung an verschiedene Arten und Schweregrade vorkommender Beeinträchtigungen zu entwickeln, vielmehr wird der Schwerpunkt auf der differenzierten und individuellen Diagnose der kindlichen Problematik und der Bedürfnisse (Bundschuh 2010, 169–178; 2019, 32–42)unter Einbezug des Umfeldes im Sinne des Helfens, Förderns, Kompensierens und des Lernens liegen. Demnach wird die sonderpädagogische Diagnostik in flexibler, dynamischer und differenzierter Weise aktiv werden im Rahmen einer Erziehung unter „erschwerten Bedingungen“ bei vorliegender Behinderung, im Rahmen einer „Fördererziehung“ bei vorliegender Störung, im Rahmen einer „Vorsorgeerziehung“ bei Gefährdung und im Rahmen der „Gesellschaftserziehung“ bei vorliegender Sozialrückständigkeit mit dem Schwerpunkt der Analyse behindernder Bedingungen im Umfeld des Kindes unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Bedingungen.
Aufgrund dieser weiten Aufgabenbereiche kann es nicht genügen, wenn der im Bereich der Sonderpädagogik tätig werdende Diagnostiker nur psychologisch-diagnostisch „in Aktion tritt“ oder handelt, er muss vielmehr zuerst auch als pädagogischer und didaktischer Fachmann ausgewiesen sein (Bundschuh 2008, 232–241), d. h. es geht um die Vermittlung zwischen Lernausgangslage und Lernen bzw. Lernfortschritt.
Zusammenfassend gesehen umfasst das sonder- und heilpädagogische Arbeitsfeld unter Berücksichtigung institutioneller Entscheidungsbereiche primär die folgenden Personengruppen:
1. Kinder, die in früher Kindheit und im vorschulischen Alter als auffällig, teilweise auch als „entwicklungsverzögert“ bezeichnet werden. Pädagogisch relevante Stichworte sind „Früherkennung“, „Früherfassung“ und „Frühbetreuung“, wobei in diesem Zusammenhang auf die ungelöste Problematik der frühen Erkennung bzw. Diagnose und Förderung hinzuweisen ist, d. h. Behinderungen können auch durch Diagnosen erzeugt werden (Bundschuh 2008, 314, 326 ff.).
Читать дальше