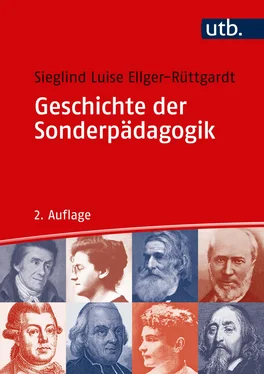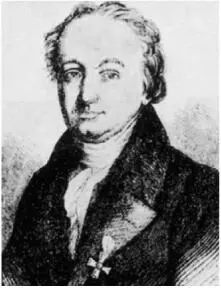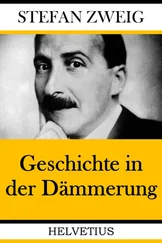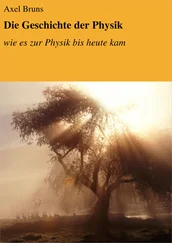Abbé Sicard
Als de l’Epée am 23. Dezember 1789, im Jahr der Revolution, starb, trug seine Unterrichtsanstalt immer noch den Charakter einer Privatanstalt. In ihr befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 60 Schüler, die entweder durch die Eltern oder verschiedene Wohltäter, teilweise auch durch die „Société philanthropique“ unterstützt wurden. Der strenge Winter 1788/89, der Ausbruch der Revolution und damit die geringer werdenden privaten Finanzmittel brachten die Anstalt in eine äußerst prekäre Lage. So erschien der Nachfolger de l’Epées, der Abbé Sicard (1742–1822), mit einer Delegation seiner taubstummen Schüler in der Sitzung der Nationalversammlung und überreichte eine Bittschrift zur Verbesserung der unhaltbaren Anstaltssituation. Die Nationalversammlung erkannte 1790 die Nützlichkeit der Anstalt an, versprach auch staatliche Protektion, machte aber zugleich den Vorschlag, die Anstalten für Gehörlose und Blinde aus Kostengründen zusammenzulegen, was wenig später tatsächlich erfolgte.
Restauration in Frankreich
Als die Taubstummenanstalt 1791 verstaatlicht wurde, erinnerte sie allerdings kaum noch an das ursprüngliche Konzept ihres Gründers. Dessen Motive waren zwar auch utilitaristischer Natur gewesen, denn es ging stets um die sozialpolitische Aufgabe einer möglichst kostengünstigen gesellschaftlichen Eingliederung von Außenseitern, aber diese Zielsetzung war nicht zu trennen von den humanitär-pädagogischen Beweggründen einer allgemeinen Menschenbildung.
Die offizielle französische Politik der 1790er Jahre setzte hingegen immer stärker auf soziale Kontrolle und Kostenreduzierung bei gleichzeitigem Zurückdrängen des Bildungsanspruches. Hierzu passt auch, dass das Taubstummeninstitut und die 1785 gegründete Pariser Blindenanstalt noch im Oktober 1791 zusammengelegt und in dem „Couvent des Célestines“ untergebracht wurden. Hauptziel der Anstalt war nun das Ausüben einer Moralerziehung und das Verdienen des eigenen Lebensunterhaltes. Nach erlassenen Richtlinien herrschte in der Institution eine klar geregelte Hierarchie, durch welche die ununterbrochene Produktivität überwacht, Müßiggang geahndet und Fleiß belohnt werden sollten. Keiner der Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, welche von den Schülern selbst hergestellt werden konnte, durfte außerhalb der Institution in Auftrag gegeben werden. Eine autarke Institution dank ökonomischer Unabhängigkeit, erwirtschaftet durch die Arbeit der Blinden und Taubstummen, das war das erklärte Ziel dieser neuen Institution, in der die Zöglinge kontrolliert und lückenlos überwacht wurden.
Es kam noch einmal im Nationalkonvent in den Jahren 1793 und 1794 zu einer hitzigen Debatte um die Funktion der Taubstummenerziehung. Dabei blieben aber jene in der Minderheit, die unter Verweis auf die Menschenrechte und das Prinzip der Brüderlichkeit den Bildungsanspruch auch für Gehörlose reklamierten. Die Vertreter der Gegenposition hingegen plädierten dafür, den Betroffenen einen Bildungsanspruch generell abzusprechen.
Die utilitaristische Ausrichtung der Taubstummenanstalt wurde in den Folgejahren fortgeführt. Für die 60 Freiplätze wurde festgelegt, dass der Staat bei einer Unterrichtszeit von fünf Jahren (im Alter von 9 bis 16 Jahren) nur für die ersten drei Jahre die Pensionskosten übernehmen würde, im vierten Jahr nur noch zur Hälfte für die Kosten aufkäme und das fünfte Jahr schließlich ganz durch die Arbeit der Schüler finanziert werden musste.
Restauration in Frankreich
Die sich nach dem Machtantritt Napoleons abzeichnende Restauration der französischen Gesellschaft mit ihrer erneuten Zementierung gesellschaftlicher Klassengegensätze bewirkte eine noch stärkere Pointierung der Nützlichkeitsbestimmung der Taubstummenerziehung bei gleichzeitiger Verfestigung ihres klassenspezifischen Charakters. In einem Prospekt aus dem Jahr 18013, welcher den Auftrag der Institution neu umreißen sollte, wurde insbesondere die gesellschaftliche Nutzbarmachung der Taubstummen hervorgehoben, eine Nutzbarmachung – so der Verfasser des Prospekts – welche die Schule de l’Epées weitgehend vernachlässigt habe. Die Leistung des Gründers wurde zwar gewürdigt, gleichzeitig aber auf das Problem verwiesen, dass die Zeit, welche von diesem für die Entwicklung intellektueller Fähigkeiten aufgewendet wurde, „fût perdu pour le travail des mains“.4 Taubstumme – so die Meinung der Verfasser des Prospektes – waren durch die ausschließlich intellektuelle Bildung zu einem müßigen und faulen Leben erzogen worden und damit weiterhin eine Bürde ihrer Eltern geblieben.
Demgegenüber wurden nun die entstandenen Werkstätten in den Vordergrund gerückt, in denen die verschiedenen Handwerke gelernt werden konnten: Druckerei, Drechslerei, Gravur, Zeichnen, Mosaik, Schreinerei, Schneiderei, Schuhmacherei. Wie bereits 1792 festgelegt, wurde auch in diesem Prospekt darauf verwiesen, dass sämtliche Gebrauchsartikel und Unterrichtsgegenstände von der Institution selbst herzustellen seien, und darüber hinaus wurde angeregt, auch andere Hospize mit den Erzeugnissen der Anstalt zu versorgen.
Als eine besondere Neuigkeit wurde die Zweiteilung der Institution angepriesen, die die gesellschaftliche Schichtung getreu widerspiegelte, indem eine spezielle Schulabteilung für Taubstumme aus vermögenden Familien eingerichtet wurde. Damit bestand die Pariser Anstalt zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus zwei strikt voneinander getrennten Sektionen, die kaum noch Gemeinsamkeiten in der pädagogischen Arbeit aufwiesen. In der ersten Abteilung befanden sich etwa 80 Taubstumme, die auf Kosten der Nation unterrichtet und nur für eine nützliche Tätigkeit ausgebildet wurden. In der zweiten, kleineren Gruppe erhielten dagegen etwa 40 taubstumme Kinder zahlender Eltern in allen üblichen Unterrichtsfächern Unterweisung.
Sozialdisziplinierung
Nicht allgemeine Menschenbildung war mehr das Ziel der Unterrichtung Gehörloser aus den armen Volksschichten, sondern soziale Disziplinierung und die Perpetuierung sozialer Ungleichheit. Für all diejenigen, die aufgrund ihres gesellschaftlichen Status zu einer frühen Berufswahl prädestiniert waren, musste demnach eine über das Notwendige hinausweisende intellektuelle Bildung als Verschwendung gelten. Somit war es nur konsequent, dass Anträge auf Freiplätze nur noch für Taubstumme im Alter von 12 bis 14 Jahren gestellt werden konnten, denn nur durch Heraufsetzung des Eintrittsalters war die erwartete Arbeitsfähigkeit der taubstummen Menschen zu gewährleisten.
2.2.2 Die Blindenanstalt
Die Parallelen zwischen den Anfängen der Taubstummen- und Blindenbildung in Paris sind unübersehbar. So ist, ungeachtet der zeitlichen Differenz, auch im Falle der Bildung von Menschen mit Blindheit eine hervorragende Persönlichkeit Motor der Anstaltsgründung: Valentin Haüy (1745–1822), Sprachwissenschaftler und königlicher Dolmetscher. Nicht anders als die Taubstummenanstalt hat auch die Blindenanstalt zunächst den Charakter einer Privatanstalt, und sie soll gerade den Kindern armer Bevölkerungsschichten offenstehen. Auch sie befindet sich permanent in einer finanziell äußerst angespannten Situation und bewegt sich in ihrem pädagogischen Konzept zwischen dem Ideal allgemeiner Menschenbildung und der utilitaristischen Festlegung auf die Hinführung zur Erwerbsarbeit.
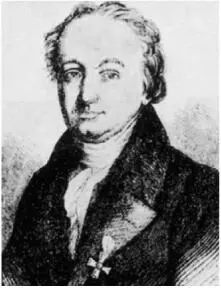
Valentin Haüy
August Zeune
Natürlich kannte Haüy wie alle gebildeten Franzosen seiner Zeit Diderots Briefe über die Blinden, aber es bedurfte eines Schlüsselerlebnisses, um in ihm den Plan reifen zu lassen, mit einem Unterrichtsversuch für blinde junge Menschen zu beginnen. Es war die unwürdige Zurschaustellung blinder, kostümierter Musikanten auf dem Pariser Markt Saint-Ovide im Jahre 1771, von der Haüy in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder berichtete und die ihn zutiefst empört hatte. Noch im Sommer 1806, als Haüy Paris Richtung Russland verließ und auf seiner Reise Halt in Berlin machte, trug er den bildlichen Beweis dieser Szene mit sich, gleichsam als symbolischen Beleg für die notwendige Befreiung blinder Menschen aus solch erniedrigender Abhängigkeit durch Unterricht und Erziehung. August Zeune, der spätere Direktor der Blindenanstalt in Berlin, erwähnte diese Episode in seinem Werk „Über Blinde und Blindenanstalten“, in dem er schrieb: „Haüy zeigte bei seiner Anwesenheit in Berlin mir einen Kupferstich, wo dieses lächerliche Tonspiel vorgebildet war, worunter noch Reimereien zur Verspottung der Blinden standen.“ (Zeune 1817, 32)
Читать дальше