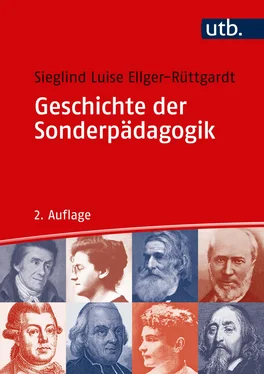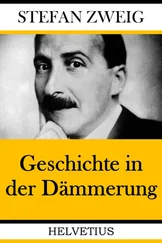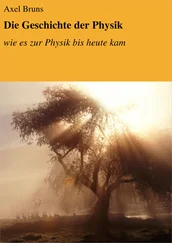Neuorganisation staatlicher Blindenfürsorge
Mit Machtantritt der Bourbonen 1815 erfolgte eine Neuorganisation der Blindenfürsorge. Die Zusammenlegung mit dem Versorgungsheim wurde zurückgenommen, und 1816 zogen die jungen Blinden in ein neues Gebäude. Aber ganz im Unterschied zu der Zeit, in der Haüy die Blindenanstalt als eine Lebens- und Selbsthilfegemeinschaft geleitet hatte, wurde sie nun als eine Einrichtung organisiert, die streng auf Effizienz ausgerichtet war und in der die blinden Zöglinge durch Unterricht und Arbeit einer straffen Ordnung und Disziplin unterlagen. Ein streng geregelter Tagesablauf, eine strikte Trennung nach Geschlechtern, das Verbot jeglichen körperlichen Kontaktes, ständige Überwachung, lange Arbeitszeiten, himmelschreiende hygienische Verhältnisse, mangelhafte Ernährung und medizinische Versorgung sowie harte Strafen – all das sind die Kennzeichen der Pariser Blindenanstalt in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.
Direktor Guillié
Ein besonders dunkles Kapitel bildet die Ära unter der Leitung des Arztes Doktor Guillié, der zur Zeit der Restauration von 1815 bis 1821 wie ein Despot in der Anstalt agierte und der nicht nur vor dem Auspeitschen und Anketten der Zöglinge nicht zurückschreckte, sondern auch mit Hilfe operativer Eingriffe medizinische Experimente an ihnen durchführte (Weygand 2003, 317ff). Kein Schüler durfte sich nach Belieben frei in der Institution bewegen; jeder, der irgendwo angetroffen wurde, musste sich ausweisen können und belegen, dass er aufgrund dieser speziellen Erlaubnis mit einem besonderen Auftrag unterwegs war.
Die 1815 beschlossene Neuorganisation des Königlichen Blindeninstituts in Paris als eine Einrichtung für Unterricht und Arbeit blieb weitgehend graue Theorie. Bis in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts hatte die Anstalt sowohl mit einer ungenügenden räumlichen Unterbringung als auch mit einer mangelhaften finanziellen Ausstattung zu kämpfen. In ihr war weder das zugestandene Lehrpersonal vorhanden noch die anvisierte Schülerzahl von 90 Freistellen realisiert. Erst 1843 konnte durch den Umzug in das Gebäude am Boulevard des Invalides, das das Institut noch heute bewohnt, für die desolate Raumsituation eine zufriedenstellende Antwort gefunden werden.
Protokolle des Verwaltungsrats
Mangelnde politische und damit finanzielle Unterstützung ließen die Pariser Anstalt in einem recht erbärmlichen Zustand verharren, der eindrucksvoll durch die Protokolle des Verwaltungsrats der Blindenanstalt während der 1820er und 30er Jahre belegt wird:

29. März 1824: Die Anstalt ist voll belegt; es gibt keine vakanten Plätze mehr; Anfragen können nicht berücksichtigt werden in nächster Zeit.
8. Juli 1824: Der Direktor und der Buchhalter berichten über die Besichtigung verschiedener Grundstücke, welche zur Errichtung einer Anstalt geeignet sein könnten; die weiteren Maßnahmen hierzu werden vertagt.
17. April 1826: Aufgrund der schlechten finanziellen Lage des Staates und demzufolge auch des Instituts, wird vom Innenminister in Erwägung gezogen, die Anzahl der Schüler zu verringern, also nicht mehr alle vakanten Plätze zu besetzen.
12. Mai 1828: Verschiedene Schüler sind ihren Familien zurückgegeben worden. Ein Schüler wurde infolge seiner Epilepsie in ein Spital aufgenommen; drei sind gestorben. Der Direktor berichtet über die große Zahl an Krankheiten in der Anstalt und die Überlastung der Krankenschwester. Der bauliche Zustand des Instituts ist schlecht; die nötigen Mittel für Reparaturen fehlen. Es ist sehr dringend nötig, ein anderes Lokal zu finden. Der Bestand der kostenlos aufgenommenen Schüler ist jetzt stark reduziert.
27. April 1830: Zwei Schüler sind gestorben. Die Krankenschwester ist überlastet, muss Unterstützung erhalten.
10. Februar 1831: Der Buchhalter ist mit der Kasse und den Unterlagen verschwunden. Die prekäre finanzielle Situation der Anstalt wird durch diesen Vorfall noch verschlimmert.
8. März 1831: Der Innenminister teilt mit, dass die finanzielle Lage des Staates den Ankauf von Gebäuden für die Institution momentan nicht erlaubt.
22. April 1831: Zwei Schüler sind gestorben.
30. März 1832: Die Cholera breitet sich in der Hauptstadt aus, und die Blindenanstalt befindet sich in den besonders gefährdeten Gebieten.
7. April 1832: Angesichts der Choleragefahr rät der Innenminister, die Kontakte mit der Außenwelt weitmöglichst zu reduzieren.
25. April 1832: Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Anstalt ordnet der Minister an, auf weitere Aufnahmen von Schülern im Moment zu verzichten. Ein Schüler ist gestorben. Auch der neu eingestellte Buchhalter ist gestorben.
20. Juli 1832: Zwei Schüler sind an Cholera gestorben.
28. Dezember 1832: Dem Minister wird in Erinnerung gerufen, dass immer noch viele Plätze in der Anstalt unbesetzt sind.
29. März 1833: Zwei Schüler sind gestorben.
31. Mai 1833: Ein Schüler ist gestorben. Der Minister ernennt 20 neue Freischüler; anschließend noch zwei weitere, um somit die vakant gebliebenen Plätze wiederum zu besetzen.
28. Juni 1833: Einer der neuen Schüler ist bereits gestorben.7
Todesfälle
Diese Berichte, die sich fortsetzen ließen, sprechen für sich und lassen keinen Zweifel aufkommen am desolaten Zustand der Pariser Blindenanstalt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wie Weygand (2003) berichtet, lagen die jährlichen Todesraten der Zöglinge zwischen 1803/04 und 1811 durchschnittlich bei mehr als vier Insassen, wobei diese statistischen Angaben eher noch als zu niedrig einzuschätzen sind. Die Sterblichkeitsrate blieb auch in den folgenden Jahren hoch, obgleich sich der Nachfolger des unsäglichen Guillié im Amt des Direktors, der Arzt Alexandre-René Pignier (ab 1821), für eine verbesserte Ausstattung der materiellen Rahmenbedingungen der Anstalt einsetzte. So waren, folgt man der offiziellen Statistik, auch unter seiner Leitung zwischen 1821 und 1838 54 Todesfälle in der Blindenanstalt zu beklagen (s. a. Henri 1952, 14ff).
Zuständigkeit: Innenministerium
Eine entscheidende Ursache für den Niedergang der Bildungsinstitute für „Sinnesbehinderte“ lag zweifellos in der zur Zeit der Revolution gefallenen Entscheidung, diese Institute nicht dem Erziehungsministerium zu unterstellen, sondern sie als Einrichtungen der Wohlfahrt dem Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums zuzuordnen. Damit war eine folgenreiche bildungspolitische Strukturentscheidung getroffen, die bis zum heutigen Tag im Bereich der Sondererziehung in Frankreich nachwirkt. Der Großteil der „klassischen“ Behinderungen gehört nach wie vor nicht zum Ressort des Erziehungsministeriums ( Ellger-Rüttgardt 2006b).
Aufgabe von Gleichheitsideal
Aber auch die ideelle Basis erwies sich als brüchig, denn die uneingeschränkte Anerkennung von Menschen mit einer Behinderung als gleichwertig war noch keineswegs Gemeingut. Mit der Diskreditierung des revolutionären Gleichheitsideals durch Restauration und staatliche sowie kirchliche Reaktion wurde folgerichtig der Personenwert behinderter Menschen erneut in Frage gestellt. Hierauf deuten Äußerungen Sicards bzw. Guilliés hin, die den Taubstummen in seinem „natürlichen“ Zustand mit einer beweglichen Maschine verglichen, welche in ihrer Organisation unterhalb der Tiere stehe, oder aber den Blinden als ein Wesen ohne Moral und nur mit einer rudimentären Gefühlswelt ausgestattet betrachteten ( Hofer-Sieber 2000, 276ff; Weygand 2003, 321).
Mit derartigen Charakterisierungen erfolgte nicht nur ein Rückschritt in den Bildungsanstrengungen für behinderte Menschen, sondern zugleich ein Rückfall in eine partikularistische und exkludierende Anthropologie. Somit manifestierte sich noch vor der Wende zum 19. Jahrhundert in den ersten Bildungsinstituten für Menschen mit Behinderung auf französischem Boden eine Abkehr vom Ideal der allgemeinen Menschenbildung. Die Kehrseite einer Pädagogik der Aufklärung, die auf ökonomische Nützlichkeit und soziale Kontrolle setzte, wurde zunehmend gesellschaftliche Praxis.
Читать дальше