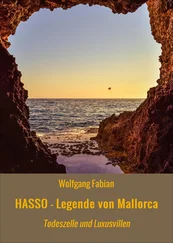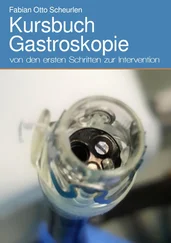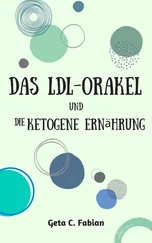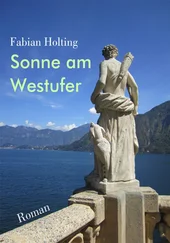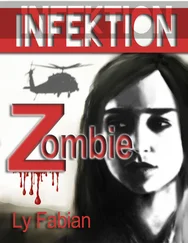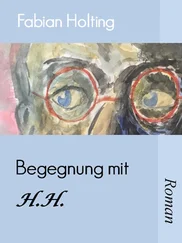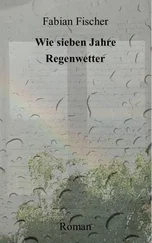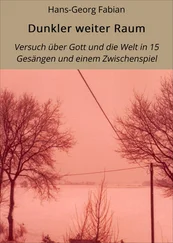In einem zweiten Schritt versuche ich in der Regel, den Text inhaltlich zusammenzufassen. Mein Angebot für die erste Strophe lautet knapp: Zwei Segelboote fahren in eine Bucht. Bei näherem Hinsehen muss ich mich (und den Text) allerdings fragen, wieso ich so selbstverständlich davon ausgehe, dass es sich um zwei Boote handelt. Könnte mit den zwei Segeln nicht auch ein Boot mit zwei Masten bezeichnet sein? Denkbar wäre auch, dass es sich nur um ein Boot mit einem Segel handelt, das sich im Wasser spiegelt und dadurch die zuvor dunkle Wasseroberfläche erhellt. Wenn ich Studierende nach ihren Vorstellungen befrage, geben in Regel etwa genauso viele ein wie zwei Boote an. Gegenüber meiner Inhaltsangabe ließe sich auch einwenden, dass das (die) Boot(e) nicht einführe(n), sondern sich bereits in der Bucht befände(n) oder gar unmittelbar davor stünde(n) aufzubrechen. Für die „Einfahrtshypothese“ spricht der Vorgang des Erhellens (Z. 1): die zuvor dunkle Bucht wird demnach durch die eben auftauchenden (womöglich weißen) Segel erhellt und damit der Ankunftsmoment markiert. Auf der anderen Seite scheint mir der Vorgang des „sich zur Flucht Schwellens“ (Z. 3) als Marker des unmittelbar bevorstehenden Aufbruchs. Warum dieses merkwürdige Changieren zwischen Ankunft und Abfahrt?, notiere ich mir als offene Frage an den Text.
Inhaltsangabe
Die Inhaltsangabe der beiden Folgestrophen birgt für mich indes weniger Diskussionsstoff und lautet in etwa: Beide Segel verhalten sich jeweils synchron, d. h. sie wölben sich im Wind jeweils genauso stark oder schwach bzw. bewegen sich genauso schnell oder langsam wie das andere. Mit diesen Erstbefunden auf dem Zettel widme ich mich meinem ersten Beobachtungsaspekt: der sprachlichen Medialität.
1Vgl. etwa die derzeitigen Definitionsbemühungen des DFG geförderten NETZWERKS LYRIKOLOGIE. KONTUREN EINES FORSCHUNGSFELDES.
2Vgl. etwa Dieter Burdorf: „Lyrik ist die literarische Gattung, die alle Gedichte umfaßt“ (Burdorf 2015, S. 20).
3Klotz 2011, S. 32.
4Lamping 1989, S. 63.
5Burdorf 2015, S. 21.
6Lamping 2007, S. 669.
7Beim konsonantischen Reim unterscheiden sich die Reimwörter nicht wie beim Endreim im Anlaut, sondern im Vokal der Stammsilbe (siehe Kap. 10).
8Vgl. etwa Strobel 2015, S. 23.
9Vgl. etwa Pfeiffer 2010, S. 54.
10Vgl. etwa den Begriff der lyrischen Präsenz bei Petra Anders (Anders 2013, S. 46).
11Schläbitz 2007, S. 10. Schlaffer zufolge sind Gedichte weniger stark von ihrem historischen Kontext beeinflusst als alle anderen Textsorten: „Alle Werke sind geschichtlich lokalisiert, aber sie gehen nicht in dieser Umgebung auf. Bereits durch ihre immanenten Formstrukturen (z. B. Metrum und Reim) heben sie sich bewußt als imaginative Synthesen inselhaft aus dem Fluß der Geschichte heraus.“ (Schlaffer 1985, S. 394).
12Bode 2001, S. 14.
13Volker Klotz spricht in diesem Zusammenhang etwa von der „All- und Alleinperspektive“ des lyrischen Ichs wie auch von dessen „All- und Alleinstimme“ (Klotz 2011, S. 35).
14Spinner 1975, S. 17.
15Vgl. etwa Waldmann 2003, S. 111 oder Schlaffer 1995, S. 40.
16Vgl. etwa Müller 2011, S. 19.
17Pielow 1978, S. 47.
18Vgl. etwa Crystal 1993, S. 73.
19Werner 2010, S. 5.
20Klotz 2011, S. 47.
21Vgl. etwa Kliewer und Kliewer 2002, S. 177.
22Vgl. etwa Kaspar Spinner: „In der Prägnanz lyrischer Sprache liegt begründet, daß Verse häufig zu einem Aha-Erlebnis führen: Der Leser findet plötzlich treffend in Sprache gefaßt, was er erlebnismäßig diffus erfahren hat.“ (Spinner 2008, S. 6).
23Vgl. etwa Anders 2013, S. 49. Hartmut Vollmer spricht sich zu Beginn seiner Verstheorie generell für eine deutlichere Bewusstmachung des liedhaften Wesens von Versen aus. Schließlich würden Verse „normalerweise gesungen“ (Vollmar 2008, S. 5) und auch der literarische Sprechvers habe sich „überall aus dem gesungenen Vers entwickelt“ (ebd.).
24Vgl. vor allem Fricke 1981.
25Anders 2013, S. 76.
26Vgl. etwa Link 1976, S. 37.
27Kliewer und Kliewer 2002, S. 105.
28Vgl. etwa Kammler 2009, S. 5.
29Hempfer 2014, S. 30.
30Vgl. etwa Pielows Rede vom „non plus ultra der Absichtslosigkeit“ bei Gedichten (Pielow 1978, S. 47).
31Culler 2008 [1997], S. 116.
32Jakobson 1972, S. 108.
33Vgl. etwa Wolf 2005.
34Vgl. etwa Pielow 1978.
35Vgl. etwa Bode 2001, S. 14.
36Christoph Bode führt hierzu aus: „Nicht-trivial ist dagegen der Nachweis, daß man Leser allein durch die Suggestion, es handle sich bei einem beliebigen Text um einen poetischen, dazu bringen kann, ihn auf bestimmte Weise recht produktiv und erhellend zu entschlüsseln – auf eine Weise, die gerade seine ‚poetischen‘ Qualitäten würdigt“ (ebd., S. 13).
37Weimar 2002, S. 110.
38Vgl. Zabka 2005, S. 79 f.
39Kammler und Noack 2012, S. 6.
40Binder und Richartz 1984, S. 14. Ähnliche Überlegungen finden sich bereits bei Juri M. Lotman: „Wir brauchen den Text jedoch nur als poetischen zu identifizieren, und sofort tritt die Präsumption in Kraft, daß alle in ihm vorkommenden Geordnetheiten einen Sinn haben“ (Lotman 1972, S. 161).
41Binder und Richartz 1984, S. 14.
42Rühmkorf kommentiert diesen vermeintlichen Widerspruch zwischen der strengen Form und dem derben Inhalt des Kindergedichts wie folgt: „Noch das plumpste Bemühen um Reim und rhythmische Gliederung verweist auf die Schranken, die die Ungezogenheit sich setzt. Noch der rüdeste Anstandsverstoß respektiert im Versmaß ein höheres Ordnungsprinzip“ (Rühmkorf 1967, S. 61).
43Spinner 2008, S. 12.
44Pielow 1978, S. 39.
45Vgl. hierzu die berühmten Kritiken an Gedichtinterpretationen von Susan Sontag (Sontag 1966) oder Hans Magnus Enzensberger (Enzensberger 1982). Vgl. auch das spöttische Gedicht GEDICHTBEHANDLUNG von Bernd Lunghard.
46Staiger 1953, S. 11.
47Petra Anders schlägt dieses Vorgehen etwa für unser Beispielgedicht ZWEI SEGEL vor (Anders 2013, S. 9).
48Vgl. etwa Kliewer und Kliewer 2002, S. 27. Vgl. auch die sinnvolle Unterscheidung von „Analyse und Mimese“ des Literaturdidaktikers Ulf Abraham (Abraham 1996, S. 173 ff.).
49Reiner Werner schreibt diesbezüglich enthusiastisch: „Es ist immer wieder verblüffend zu sehen, wie bei Schülern die Fähigkeit im Verständnis von Gedichten zunimmt, wenn sie anfangen, selber Gedichte zu schreiben. Der Einblick in die ‚Werkstatt‘ des Dichtens setzt bei Schülern nicht nur kreative Kräfte frei, sie macht sie auch sensibler für die Techniken, die andere Dichter, die großen zumal, bei ihren Gedichten angewendet haben“ (Werner 2010, S. 67).
50In diesem Zusammenhang sind Susann Körners Kassenzettel-Gedichte sehr zu empfehlen (Körner 2001).
51Vgl. hierzu auch Müller-Zettelmann 2000, 67 f.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.