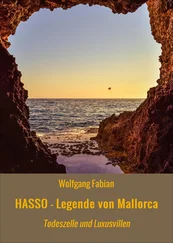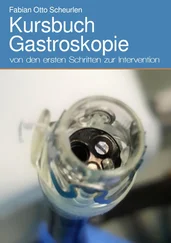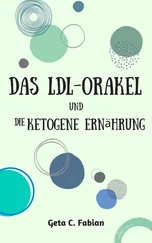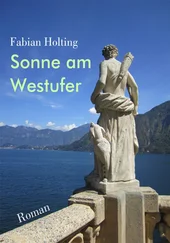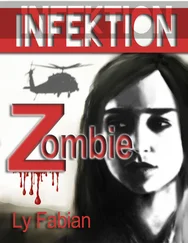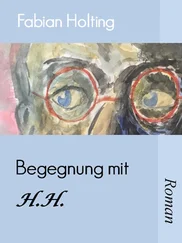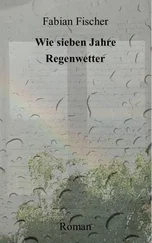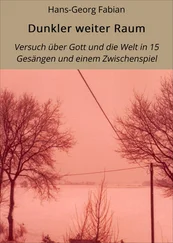Fabian Wolbring - Sprachbewusste Gedichtanalyse
Здесь есть возможность читать онлайн «Fabian Wolbring - Sprachbewusste Gedichtanalyse» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Sprachbewusste Gedichtanalyse
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Sprachbewusste Gedichtanalyse: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Sprachbewusste Gedichtanalyse»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Sprachbewusste Gedichtanalyse — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Sprachbewusste Gedichtanalyse», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Formale Kennzeichen
Im REALLEXIKON DER DEUTSCHEN LITERATURWISSENSCHAFT findet sich eine sehr knappe, rein formale und anscheinend recht verbindliche Minimaldefinition von Gedicht, die da lautet: „Text in Versen“ 6. Obgleich sich auch die offenkundige Anschlussfrage, was denn nun eigentlich ein Vers sei, trefflich diskutieren ließe (siehe Kap. 9), erfüllt Dickis Aussage dieses Kriterium geradezu bravourös: Acht trochäisch geordnete Silben (betont/unbetont) formen zwei Verse mit deutlicher Zäsur dazwischen. Darüber hinaus erfüllt der Text mit seinen markanten Endreimen („Zacke“ auf „-kacke“), wie auch mit dem konsonantischen Binnenreim („Zicke“ auf „Zacke“), 7das landläufig wohl verbreitetste Klassifizierungs-Kriterium des „Gereimtseins“ (siehe Kap. 10). Und auch das ebenfalls formale Kriterium der „relativen“ Kürze 8lässt sich attestieren.
Landläufig wird die Gattung zuweilen auch inhaltlich oder thematisch bestimmt. So wird sie etwa häufig als „Affektgattung“ aufgefasst, die konstitutiv von einem „lyrischen Ich“ handle, das durch das Gedicht seine Emotionen zum Ausdruck brächte. 9Entsprechende Liebes- oder Sehnsuchtsgedichte zählen sicher zu den populärsten Texten der Gattung, doch in Dickis Fall ist davon zunächst nichts zu entdecken (auch wenn man durchaus Rückschlüsse auf dessen Gefühlslage ziehen könnte [s. u.]). Ebenfalls schwierig erscheinen inhaltliche Bestimmungsversuche, nach denen Gedichte stets bestimmte Augenblicke oder Situationen einfangen. 10Davon ist bei Dickis Text nichts auszumachen. Eher fängt der Sketch eine Situation ein (Weihnachtsabend) und Dickis Verse bilden eine grundsätzlich situationsunabhängige, beliebig rekontextualisierbare Einheit. Auch die Einschätzung, Gedichte lieferten „prägnant[e] Zeitdiagnosen“ 11ihrer jeweiligen Epoche, überzeugt in diesem Fall nicht. Der Sketch mag das deutsche Spießertum der späten 70er portraitieren oder persiflieren, doch Dickis Worte wirken als typische Kinderverse merkwürdig ahistorisch.
Inhaltliche Kriterien
Insgesamt passender erscheinen da Bestimmungsversuche, nach denen der Inhalt bei einem Gedicht eben keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt, weshalb es als „semantisch entlasteter“ Text besonders „ästhetisch“ wirken könne (s. u.). Oder geht es womöglich wirklich um Hühnerkacke? Vielleicht solche, die im „Zickzack“, also kreuz und quer im Hühnerstahl verteilt wurde? Und wie verhält es sich mit der These, Gedichte hätten als „autoreferentielle Texte“ 12stets sich selbst zum Inhalt? Trifft dies auf ein „Zicke, Zacke – Hühnerkacke.“ auch zu?
das „lyrische Ich“
Nicht einmal ein explizites „lyrisches Ich“ taucht im Gedicht auf, das ebenfalls gelegentlich als bestimmendes Merkmal der Gattung angegeben wird. 13Aber gibt es nicht immer ein Äußerungssubjekt, also jemanden, der das „Zicke, Zacke – Hühnerkacke.“ notwendigerweise spricht oder gesprochen haben muss (siehe Kap. 2)? Kaspar Spinner definiert das „lyrische Ich“ als „Leerdeixis“ 14, d. h. als unbesetzte Sprecherrolle, die weder vom Autor noch von einer näher bestimmbaren Figur eingenommen wird. 15Tatsächlich erscheint auch unser Gedicht weder als die unmittelbare Aussage der Figur Dicki (die eher zu rezitieren scheint), noch als die des Sketch-Autors Loriot. Vermutlich ist Loriot auch nicht der Autor des Gedichts, sondern es handelt sich um jahrzehntelang bekannte Verse eines längst vergessenen Urheber-Kindes, die – ganz im Sinne einer Leerdeixis – bereits von zahllosen Sprecherkindern zitiert und adaptiert wurden. Aber wäre ein Verstext, bei dem das Äußerungssubjekt eindeutig einem Autor oder einer Rolle zuzuschreiben ist, demnach kein Gedicht?
poetische Sprache?
Häufig liest man auch, Gedichte seien durch eine eigene, eben „poetische Sprache“ gekennzeichnet, die von der „Normalsprache“ zu unterscheiden sei. 16Aber wodurch? Etwa durch ein eigenes Vokabular? Die Worte „Zicke“ und „Zacke“ – insbesondere im Zusammenspiel – erscheinen mir tatsächlich nicht dem alltagssprachlichen Lexikon zuzugehören; „Hühnerkacke“ indes schon. Es ist offensichtlich nicht Teil jener gedichtexklusiven „gesteigerten Sprache“, die, dem Literaturdidaktiker Winfried Pielow zufolge, „auch noch das ‚Zarteste‘ sagen kann“, 17und auch nicht jenes konventionellen Registers „poetischer Sprache“, das Begriffe wie Ach! und Weh!, Herzeleid, Nymphe oder Windeshauch enthält. 18Reicht das aus, um Dickis Versen den Status „Gedicht“ abzuerkennen? Dass Gedichte gemeinhin einen entsprechend erhabenen Stil oder „hohen Ton“ erwarten lassen, zeigt sich daran, dass dessen Nichtentsprechung letztlich die Komik des Sketches generiert. Von einer gedichttypischen „verdichteten Bildsprache“, 19die sich wohl etwa im metaphorischen bzw. symbolhaften Gebrauch von Begriffen wie Rose, Schiff oder Sonne niederschlägt, ist bei Dicki ebenfalls nichts zu erkennen. Zumindest fiele mir nichts ein, wofür die Hühnerkacke hier Symbol oder Metapher sein könnte. Die poetische Sprache von Gedichten – so liest man – sei dazu imstande, im „synästhetischen Vollzug“ 20mehrere Sinneswahrnehmungen zu verschränken, doch Dickis Zeilen erwecken in mir (zum Glück) weder bildliche, noch haptische oder gar olfaktorische Vorstellungen. Mal liest man, die Sprache im Gedicht zeichne sich durch ihre Mehrdeutigkeit aus 21und mal durch ihre Prägnanz und darstellerische Genauigkeit. 22Mal gilt sie als besonders hermetisch (also verschlossen) und mal als genuin assoziativ; ein anderes Mal als besonders klangvoll, harmonisch oder gar musikalisch. 23Letzteres mag auf Dickis Verse, die tatsächlich den Charakter eines Spottliedes haben, durchaus zutreffen, aber der Rest? Mir fällt es schwer, in den Zeilen einen klaren Sinn zu erkennen, aber ist es deswegen schon hermetisch oder mehrdeutig? Ich finde sie (vor allem im Weihnachtsabendkontext) auch durchaus drastisch; aber besonders prägnant oder genau?
Für unser Vorhaben, im Gespräch mit Gedichten die Wirkungsweise von Sprache zu reflektieren, erscheint mir die Vorannahme, Gedichte würden eine genuin „andere“ Sprache verwenden als andere Texte, nicht zielführend. Eher nutzen sie dieselbe Sprache wie alle auf gedichtspezifische Weisen, um die oben genannten Effekte (oder auch andere) zu generieren. Ihre AutorInnen wenden womöglich bestimmte Verfahren bei der Erstellung eines Gedichtes an, d. h. sie folgen (bewusst oder unbewusst) bestimmten Regeln und Grundsätzen (Poetiken) bei der Konzeption ihrer Texte und produzieren so den Eindruck von Poetizität, d. h. eines ungewöhnlich kunstvollen Sprachgebrauchs. Aber was genau macht diese Verfahren aus?
Normen im Gedicht
Gelegentlich wird die Position vertreten, dass in Gedichten Sprachnormen überschritten 24und die basalen Anordnungs- und Flexionsregeln sprachlicher Äußerungen (Syntax und Grammatik) nicht länger gelten würden. Für Dickis Verse ließe sich etwa feststellen, dass sie keinen vernünftigen deutschen Satz bilden, weil ihnen das Prädikat fehlt. Andererseits liest man auch, dass Gedichte dadurch gekennzeichnet wären, dass sie vielmehr zusätzlichen Anordnungsregeln folgten, die im alltäglichen Sprachgebrauch missachtet würden. Typischerweise sind dies (wie bei Dicki) Vers- oder Reimmuster, die eingehalten werden (müssen?), möglicherweise aber auch Prinzipien wie eine festgelegte Wortanzahl, bestimmte Lautmuster (z. B. nur „dunkle“ Vokale) oder auch ein bestimmtes Vokabular (z. B. viele „Farbwörter“). Muster entstehen dabei vor allem durch Wiederholungsstrukturen und Rückbezüge (Rekurrenzen) im Text, zumeist in Form von Variationen.
Überstrukturiertheit
Besonders beliebt ist die Vorstellung, der Sprachgebrauch im Gedicht sei dadurch gekennzeichnet, dass er Form und Inhalt in Einklang brächte, also eine „Gestalt-Gehalt-Korrespondenz“ 25generiere. Das Wie der Darstellung entspräche folglich dem Was des Inhalts, etwa indem ein wilder Galopp in einem entsprechend „galoppierenden“ Sprechrhythmus umgesetzt oder eine traurige Stimmung mit vielen dunklen Vokalen „orchestriert“ würde. Gerade in diesem Zusammenhang taucht im theoretischen Diskurs gelegentlich der Begriff der Überstrukturiertheit von Gedichten auf. Überstrukturiertheit bedeutet, dass die Sprache in Gedichten auf unterschiedlichen Ebenen bedeutungstragend eingesetzt wird. 26Während in der Alltagssprache die Sätze und Wörter vorwiegend semantisch eindeutig in ihrer lexikalischen Grundbedeutung (Denotation) benutzt würden, seien im Gedicht auch assoziative Nebenbedeutungen (Konnotationen) relevant und auch der Klang der Wörter und der Rhythmus der Verse würden bedeutungstragend eingesetzt. Demnach kommuniziert ein Gedicht also „mehrkanalig“ und die dadurch gleichzeitig vermittelten Botschaften können zueinander in Beziehung gesetzt werden. Klappt das auch bei Dicki? Nun ja, man könnte etwa sagen: das Wort „Hühnerkacke“ hat neben seiner denotativen Bedeutung als Bezeichnung für Unrat, diverse konnotative Nebenbedeutungen durch seine Assoziationen mit Unwerten, Unnützem, Schmutzigem, Lächerlichem, aber auch Ländlichem, Bäuerlichem etc. „Zicke, Zacke“ hat anscheinend keine unmittelbare denotative Bedeutung (s. o.). Oder ist mit Zicke doch eine weibliche Ziege gemeint (die ja thematisch gut zum Huhn passen würde)? Immerhin wird dieses Wort vielfach auch figurativ und abwertend für „launische Frauen“ verwendet. Für mich klingt die Wortfolge aber eher nach Tempo und Bewegung; ähnlich wie zackig oder Ruckizucki oder auch nach Hin und Her. Reim und Rhythmus verhelfen den Worten dann zudem zu einer liedhaften Komponente, die ihnen den Charakter eines Spottliedes verleihen, vergleichbar mit dem trotzigen Näh-NähNäh-Näh-Näh eines entwischten Kindes beim Fangenspiel. Lassen sich die vermeintlichen „Bedeutungen“ der unterschiedlichen Ebenen denn nun sinnvoll zu einer einzigen Bedeutung zusammenführen? Womöglich gar zu einer Botschaft oder „Lehre“ 27für die Leser? Ist das überhaupt nötig? Und welche könnte das sein? Und wer hat sie dort „versteckt“?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Sprachbewusste Gedichtanalyse»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Sprachbewusste Gedichtanalyse» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Sprachbewusste Gedichtanalyse» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.