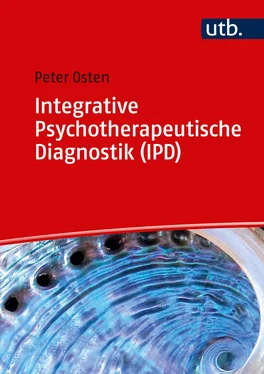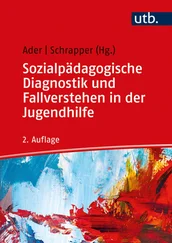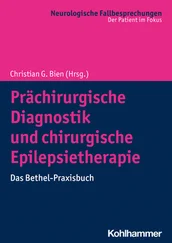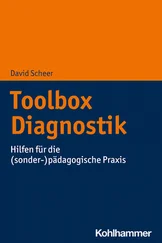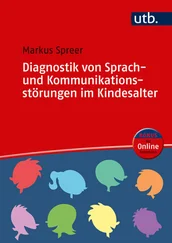1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Auch wenn ich Leib bin, kann ich in Exzentrizität hierzu treten und meinen Leib zum Gegenstand der Aufmerksamkeit machen (Plessner, 1982). Ein Resultat von Bewusstheit und Exzentrizität, von Aneignung eigenleiblichen Spürens, Reflektierens und Konnektivierens ist das, was die Psychologie mit großer Selbstverständlichkeit wie eine eigene Entität behandelt und das „Selbst“ nennt. Bei Sokrates war das die Seele, die den Körper und alle Dinge benutzt. In platonischer und auch in cartesianischer Tradition nimmt dieses Selbst vom Körper Gebrauch und vergisst, dass es selbst Leib ist . So wie das Ich jedoch eine Bezeichnung für eine Konstruktion ist, so wird auch das Selbst als eine Konstruktion des Geistes verstanden. Allerdings stellt diese sich als eine durchaus selbstbewusste, sich verselbständigende dar: Das Ich und das Selbst haben nicht das Selbstverständnis, eine Konstruktion zu sein. Damit aber das Selbst als ein Eigenes erfahren werden kann, müssen wir es uns erst aneignen. Diese Aneignung ist aber genau nicht als Inbesitznahme zu verstehen, sondern als eine Hinwendung, als ein Versuch, Einvernehmen damit zu erreichen, dass das Leben nicht nur Handlung, sondern auch Widerfahrnis ist. Dies bezeichnet die „Urtatsache, dass uns etwas zustößt, zufällt, auffällt oder einfällt, dass uns etwas glückt oder auch verletzt“ (Waldenfels, 2015, 20). Somit geht es also darum, aus der Entfremdung von der Leiblichkeit in eine Form der Teilhabe oder sogar Vertrautheit mit ihr zurückzufinden.
Vom Kopf auf die Füße gestellt, müssten wir daher aus leibphilosophischer Sicht von einem „Leib-Selbst“ sprechen (Petzold, 2011), in philosophischer Hinsicht von einem „Selbst-Sein, das sich selber denkt“ (Henrich, 2016), und weiter von einem Selbst, das weder transzendent noch naturalistisch, sondern rein phänomenologisch verstanden werden kann (Metzinger, 1995, 1996). Dieses könnte sich dann zumindest auch als Natur denken – als ein Teil von etwas – und seine Biologie als eine Kategorie der Leiblichkeit verstehen. In Identifikation mit seiner eigenen Grundlage müsste dem personalen Selbst mit dem ,Körper‘ nicht notwendig etwas Fremdes entgegentreten, wodurch die Person ihrer Kraft und Produktivität beraubt werde. Es könnte sich synthetisieren mit der Natur der eigenen Leiblichkeit, sich sogar eingemeinden lassen, das heißt, sich eingelassen und verbunden fühlen.
In dieser Verbundenheit besteht das Selbst-Sein im Natur-Sein vor allem darin, dass die Lebensvollzüge eine latente Selbstbezüglichkeit erhalten. Wie der Mensch seine Natur erfährt, hängt nicht nur von seiner Ökologisation, seiner Sozialisation in Lebenswelt und Einbettung in die Natur, ab (Petzold, 2016), sondern auch von seinem Verhalten zu sich selbst. Herrmann Schmitz (2007a) nennt das „leibliche Betroffenheit“, Gernot Böhme (2008, 165ff.) auch die „betroffene Selbstgegebenheit“. Sie zeigt sich im Schönen und in der Emphase genauso wie im Leiden. Sie zeigt sich außerdem in der Erfahrung des Getragen-Seins von einer Natur, die auch „nicht ich selbst bin“. Hier geht es also nicht nur um das Erlangen eines „partnerschaftlichen Verhältnisses“, sondern um das unhintergehbare Verständnis, dass die eigene Natur weder vollständig zu verinnerlichen noch vollständig zu veräußerlichen ist (Thürnau & Barkhaus, 1996). In diesem Sinn, und auch weil der Leib dem Menschen damit erste und letzte Autorität ist, stellt sich die Beziehung des ,autonomen Subjekts‘ zu ihm oft als scharfkantige Herausforderung dar.
Reflektierend nimmt der Mensch von sich Abstand und wird so zum bewusst Handelnden. Diese Reflexivität aber schießt über ihr Ziel hinaus, der postmoderne Mensch vergisst, dass er auch Kontingenzen und Widerfahrnissen ausgesetzt ist, und er versteht sich in der Moderne nur noch als handelndes Subjekt. Für alles, was ihm widerfährt, glaubt er nicht nur final Verantwortung übernehmen zu müssen – das wäre hinzunehmen –, sondern er hält sich auch kausal für alles verantwortlich. Hierin zahlt er den Preis dafür, sich vom Leib, von der eigenen Natur, die ihn trägt, von der Welt als ein autonomes Selbst distanziert zu haben. Regungen und Bewegungen des Leibes aber setzen sich durch, unbeachtet und unbewegt vom Ich, das im Gespinst seiner Ideen gefangen bleibt (Böhme, 2017).
Vom Menschen muss der Leib daher als etwas Gegebenes betrachtet werden. Er ermöglicht innerhalb der Grenzen, die ihm gesetzt sind, Handlungsspielräume, er zeigt aber auch Limitierungen auf, die wir nicht ohne Schaden zu nehmen überschreiten können. Man wird sich daher mit Gernot Böhme (ebd.) fragen, ob in der Moderne nicht eine gewisse Bereitschaft, sich etwas geben zu lassen, notwendig ist, um den Ernst der eigenen Existenz zu wahren – Gutes wie Herausforderndes.
So behandeln auch die Naturwissenschaften das Menschsein in einem Modus, der das Selbst-Sein ausblendet. Bei all dem ist freilich zu bedenken, dass der Cartesianismus, der in unserer Kultur gelebt wird, uns spaltet in ein Ich und ein Körperding, das dieses Ich zu seinen Zwecken nutzt. Das Programm der Leibphänomenologie will aufzeigen, wie tief diese Differenz in unserem Denken eingesenkt ist und wie ungesund diese Entfremdung wirkt.
Die Leibphilosophie (Böhme, 1985) stellt den Aspekt des Lebens als Widerfahrnis in den Vordergrund, weil das leibliche Sich-gegeben-Sein zunächst immer eine pathische Erfahrung ist, also etwas, das einem geschieht. Es sind nicht die Akte des Willens, der Handlung oder des Ichs allein, in deren Gefolge das Leibsubjekt in Erscheinung tritt. In der Dialektik der Aufklärung stellen Horkheimer und Adorno (1988) den Ursprung des Subjekts als Ergebnis einer Überlebensstrategie des Menschen dar. Die Entzweiung von Natur und Vernunft habe dem Menschen die Beherrschung der äußeren Natur ermöglicht. Der Preis dafür war die Unterwerfung auch der eigenen Natur. So entstand das autonome Subjekt als Abhebung von seiner eigenen Natur. Das Subjekt wird in dieser Vorstellung als Instanz der Naturbeherrschung vollkommen entleiblicht.
Böhme (2008) hingegen sucht den Ursprung des Subjekts nicht in der Entzweiung mit der Natur, sondern aus der Leiblichkeit selbst heraus zu deuten. Die Furcht vor dem Leiden, Scheu vor der Regression, die Angst vor dem Selbstverlust, das sind Themen, die das Einverständnis mit der eigenen Natur behindern. Er definiert den Ursprung des Subjekts genau hier, in der Erfahrung von Schmerz, wo keine andere Theorie eine Fundierung des Selbst für möglich halten würde: „Es ist das verpanzerte Ich, das sich auf solche Erfahrungen nicht einlassen will oder kann“ (ebd., 143). Es ist die „Enge eines auf sich zurückgeworfenen Lebensvollzugs, aus dem das Ich sich losreißt“ (ebd.), gleichzeitig kann es aber seine Eingelassenheit in den Leib wieder erleben.
Dem Schmerz ist eine Betroffenheit mitgegeben, die das Ich-Bewusstsein im ersten Moment in den Hintergrund treten lässt. Angst, Schmerz, Hunger, Durst usw. rufen eine Ahnung oder sogar die Gewissheit der Selbstgegebenheit auf den Plan – ein Ich ist dafür noch nicht vonnöten. Der Schmerz wird zunächst als etwas Fremdes erfahren, das mich aber angeht: „Es schmerzt mich.“ Es ist der Schmerz, der mir den Körper unausweichlich als meinen Leib zuordnet (ebd., 156). Das phänomenologisch verstandene Leib-Selbst erlebt sich verwundbar im „Urzustand seiner kreatürlichen Unfreiwilligkeit“ (Lévinas, 1998; Czapsky, 2017) oder im Zustand seiner „Jemeinigkeit“, wie Heidegger (1929) es ausdrückte. Erst im Austritt aus der Regression des Schmerzes bildet sich das Ich, das nun konstatiert: „Ich habe Schmerzen“, und das diese Schmerzen nun im nächsten Schritt – entfremdet – als Sachverhalt des Körpers versteht und behandelt. Diese Form „leiblich betroffener Selbstgegebenheit“ ist bei Böhme das Prinzip der Subjektivität.
Читать дальше