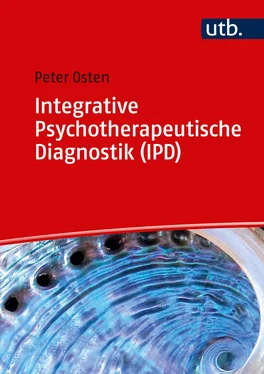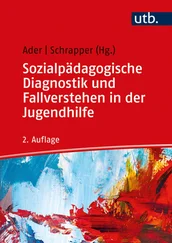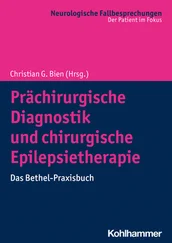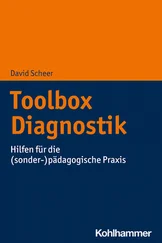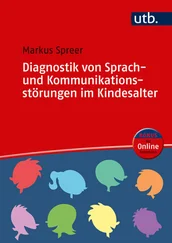Noch deutlicher wird das Erfordernis leiblicher Anwesenheit im Bereich der Kommunikation, wenn diese nicht mehr nur auditiv und visuell ablaufen soll. Hier geht es um eine Aktualisierung gemeinsamer leiblicher Anwesenheit (Böhme, 2017). In der Unmittelbarkeit des Sich-in-Augenschein-Nehmens, der freundschaftlichen Berührungen, des unverfälschten Hörens einer Stimme, des Sich-zu-erkennen-Gebens (Bauer, 2012; Henry, 2018) usw. wird jede Form der Subversivität, die die elektronischen Medien ermöglichen, in konkrete leibliche Kommunikation verwandelt. Noch bevor das erste Wort gesprochen ist, wird man bereits vom Gegenüber wahrgenommen, steht man schon in Beziehung, hat man sich bereits zu verantworten. Dass diese Herausforderungen für den postmodernen Menschen oft schon zu viel sind, man sich lieber hinter Bildschirme zurückzieht, spricht für die Entfremdung von leiblicher Präsenz. Selbst ein lebendiges Schweigen in leiblicher Anwesenheit mutiert so zum vakuumierten Warten auf die Antwort nach dem Absenden einer WhatsApp-Nachricht.
Leibliche Präsenz ist Öffnung in den sozialen und ökologischen Raum. Sie ist eine mit den Kommunikationspartnern praktizierte gegenseitige Versicherung gemeinsamer Anwesenheit. Vom einfachen Austausch ausgehend, lässt sie sich steigern in Formen geteilter leiblicher Ökonomie, etwa beim Singen, Musizieren oder bei gemeinsamer Arbeit, weitergehend in erotischer Intimität; in ihre höchste Steigerung gelangt diese Form der „Einleibung“ (Schmitz, 2007a) in der leiblichen Liebe und sexuellen Geschlechtlichkeit.
Mit der Wahrnehmung von Geschlechtlichkeit wird deutlich, wie wenig Leiblichkeit in ihrer sexuellen Dimension eine ganz persönliche Angelegenheit bleiben kann. Spätestens hier wird die Öffnung des Leibes hin zum „social body“ (Petzold, 2011a) evident. Und das in mehreren Weisen. Es trifft in erster Linie für alle Formen zwischenleiblicher Kommunikation zu, hier befinden wir uns noch auf der eher angenehmen Seite. Wie sehr die Geschlechtsleiblichkeit auch im größeren sozialen Raum verankert und durch ihn bestimmt wird, erfahren wir, wenn wir wahrnehmen müssen, mit welcher Wucht, zum Teil Gewalttätigkeit, Religiöses, Gesellschaftliches, Politisches und Wissenschaftliches in das sexuelle Leib-Subjekt drängt und es zu kolonialisieren trachtet. Foucault (1987) hat das Biopolitik und Gouvernementalität genannt (Nancy, 2014b; Gugutzer, 2015).
Dabei geht es nur an der Oberfläche um Definitionen sexueller Präferenzen. Der „anonyme Diskurs“ der Gesellschaft (Foucault, 2005, 2012) will nicht nur bestimmen, was unter Männlichkeit und Weiblichkeit, was unter Geschlechtsdifferenz, unter Heteronormativität und Geschlechtsdissidenz verstanden sein soll, er will in das gesamte Leben der Geschlechter regulativ eingreifen, bis hinein in intimste Wertigkeiten (Bourdieu, 1992a). Hier wurde bis vor 30 Jahren noch entschieden, wer sich ohne strafrechtliche Verfolgung lieben, und neuerdings auch, wer rechtlich abgesichert heiraten darf. Der zeitepochale gesellschaftliche Diskurs will geschlechtersensible Optionen beruflicher Karrieremöglichkeiten fixieren, vergütungsrechtliche Machtdynamiken installieren, das Sexual- und Reproduktionsgeschehen, Abstammungsverhältnisse und das Sorgerecht bis ins Detail geregelt wissen.
Spätestens in der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtlichkeit also verlässt das Individuum die eben noch diskutierten Möglichkeiten intimen eigenleiblichen Spürens und tritt ein in die Gefahrenzone gesellschaftlicher und sozialer Okkupation. Plessner (1965) konstatiert, dass der Mensch in einer exzentrischen Position jeweils darüber zu bestimmen hat, ob er einen Körper hat oder Leib ist, bei Husserl (1913) wird der Leib als Umschlagstelle zwischen Natur und Kultur charakterisiert, bei Merleau-Ponty (1966) taucht im selben Zusammenhang der Begriff der Ambiguität auf, obwohl er in der Geschlechtlichkeit die primäre Intentionalität des Menschen sieht.
Während Einigkeit darüber zu bestehen scheint, dass der Leib weder der einen noch der anderen geschlechtlichen Kategorie zuzuordnen ist, stößt man im Versuch, aus der breit entwickelten französischen und deutschen Phänomenologie Aussagen über die leibliche Wahrnehmung von Geschlechtlichkeit zu erfahren, auf die erstaunliche Tatsache, dass Untersuchungen hierüber vernachlässigt worden sind. Wie ist es möglich, dass Leibsein nicht von vornherein und grundsätzlich geschlechtlich verstanden und differenziert wurde? Wie ist es möglich, dass beim Bewusstsein über die kulturelle Dimension der Leiblichkeit die Geschlechtlichkeit nicht von Beginn an mitgedacht wurde? Der Schrecken, dass der intimste Bereich menschlichen Spürens und lustvoller Existenz gleichzeitig Austragungsort destruktivster persönlicher und gesellschaftlicher Macht- und Kontrolldynamiken darstellt, mag einen der am weitesten tabuisierten Gründe hierfür darstellen.
Im Hinsehen auf Geschlechtlichkeit taucht die heikle Frage auf, ob das Geschlecht im biologischen Sinn „Natur“ oder epigenetisch als Resultat der Sozialisation verstanden werden soll. Während für soziale und gesellschaftliche Zuschreibungen im geschlechtlichen Sinn in allen Fällen Zweiteres gilt, finden wir in der Unbestimmtheit des Begriffes „Natur“ den Kampfschauplatz der sogenannten Genderdebatte unserer Zeit wieder. Das Kernproblem dabei ist, dass gesellschaftlich-kulturelle Erwartungen oder Zuschreibungen geschlechtlicher Eigenschaften historisch an körperlichen Merkmalen festgemacht wurden, ähnlich denen des Rassismus. Zwei machtvolle Diskurse, einer die Natur, der andere die Kultur betreffend, beanspruchen – sozusagen über den Kopf des Subjekts hinweg –, dessen Leiblichkeit bestimmen zu wollen. Es ist seltsam, wie wenig bei allem Reden über Emanzipation das Subjekt, egal, ob männlich, weiblich oder X, sein eigenleibliches Spüren gegen beide Ansprüche zu verteidigen vermag. Die Auflehnung gegen solche Okkupation scheint nur durch persönliche Revolte möglich zu sein (Camus, 1953).
Unter leibphänomenologischer Sicht indessen wird „Natur“ nicht gleichgesetzt mit „Biologie“, noch weniger mit „Kultur“. Zwischen dem naturwissenschaftlich bestimmten Körper (Geschlechtskörper) und gesellschaftlich präformatierten Geschlechtsrollen (Geschlechtsidentität) befindet sich ein durch Zeugnisse der Wahrnehmung und des eigenleiblichen Spürens der Geschlechtlichkeit subjektiv und phänomenologisch wahrgenommener Leib (Geschlechtsleib). Nur diese, als subjektive Natur verstandene, Erfahrung soll in diesem Kapitel nun Gegenstand der weiteren Auseinandersetzung hinsichtlich des Begriffes „Natur“ sein (vgl. Gahlings, 2016; Böhme, 2017; Schigl, 2012).
Zum Subjektsein gehören unverbrüchlich dreierlei elementare Wahrnehmungen der Geschlechtlichkeit: erstens die Fremdwahrnehmung, zweitens das Wahrnehmen und Spüren am eigenen Leib und drittens die psychosoziale Konstruktion eigener Vorstellungen hierzu. Diese Reihenfolge ist diejenige, die der menschlichen Entwicklung entspricht, und aus ihr leiten sich bereits einige der zentralen Problemstellungen ab, die mit Sex (als biologischem Körper) und Gender (als sozialkonstruktivistischem, behavioralem Geschehen) in Zusammenhang stehen.
Unabhängig davon, wohin die Identitätskonstruktion im Leben eines Menschen sich entwickeln mag, geht die erste geschlechtersensible Projektion auf den Leib aus der sozialen Umgebung als Fremdwahrnehmung des morphologischen Geschlechts hervor. Drei weitere Ebenen der Bestimmung des biologischen Geschlechts – genetisch, hormonell, neuronal – bleiben davon zunächst unberührt. Sie kommen erst beim Auftreten ernster Fragen um das Geschlecht zum Vorschein, dann meistens im medizinischen Kontext (Steins, 2010). Insofern zeigt sich Geschlechtlichkeit zu Beginn des Lebens als etwas „Pathisches“, als etwas, das einem widerfährt (Böhme, 2017).
Читать дальше