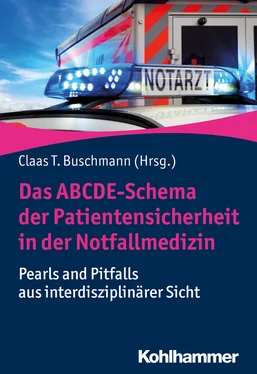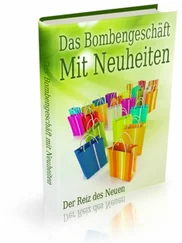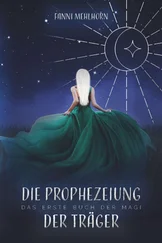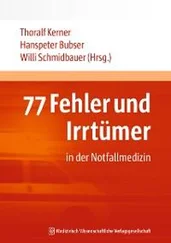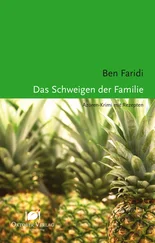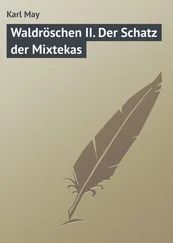Timmermann A, Böttiger BW, Byhahn C, Dörges V, Eich C, Gräsner JT, Hoffmann F, Hossfeld B, Landsleitner B, Peipho T, Noppens R, Russo SG, Wenzel V, Zwißler B, Bernhard M (2019) S1 Leitlinie Prähospitales Atemwegsmanagement 02/2019. Registernummer 001-040. ( https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/001-040l_S1_Praehospitales-Atemwegsmanagement_2019-03_1.pdf, Zugriff am 03.05.2020).
Timmermann A, Nickel EA, Puhringer F (2015) Larynxmasken der zweiten Generation: Erweiterte Indikationen. Anaesthesist 64: 7–15.
Timmermann A, Russo SG (2017) Neubewertung extraglottischer Atemwegshilfsmittel in der Notfallmedizin. Notfallmedizin up2date 12: 143–155.
A2 Endotracheale Intubation
Lennert Böhm und Michael Bernhard
A2.1 Epidemiologie der Atemwegssicherung
Aktuelle Studien gehen davon aus, dass rund 10 % aller Patienten im bodengebundenen Notarztdienst und 5 % aller Patienten in luftgestützten Systemen eine Atemwegssicherung und Beatmungstherapie benötigen. In einer aktuellen Arbeit wurde anhand der Datensätze der Stelle zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung im Rettungsdienst Baden-Württemberg (SQR-BW) der Jahre 2015–2017 mit insgesamt 12.605 eingeschlossenen Datensätzen zur prähospitalen Notfallnarkose gezeigt (Luckscheiter et al. 2019), dass
• 15 % eine Notfallnarkose aufgrund eines kardialen Ereignisses,
• 10 % aufgrund einer akuten respiratorischen Insuffizienz,
• 33 % aufgrund eines akuten neurologischen Defizits,
• 28 % infolge eines Traumas und
• 14 % aufgrund einer sonstigen Konstellation erfolgen.
A2.2 Indikationen zur Atemwegssicherung
Das wesentliche Ziel einer prähospitalen Atemwegssicherung, ist die Aufrechterhaltung der Oxygenierung und Ventilation des Notfallpatienten. Dabei gilt, dass bei bestehender Indikation ohne das Gelingen einer Atemwegssicherung und damit der Sicherstellung von Oxygenierung und Ventilation, alle anderen Maßnahmen irrelevant sind, da der Patient definitiv verstirbt.
Ein beträchtliches – aber vermeidbares – Risiko entsteht, wenn eine Atemwegssicherung ohne entsprechend sinnvolle Indikation durchgeführt wird, beispielweise wenn ein Patient nur eine kleine Verletzung aufweist und dann nach Einleitung einer Notfallnarkose infolge einer Fehlintubation eine Hypoxie erleidet. Vor diesem Hintergrund ist die strenge Indikationsstellung zur prähospitalen Notfallmedizin und Atemwegssicherung absolut essenziell und grundsätzlich zu fordern.
An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen werden, dass die Atemwegssicherung bei Patienten im Herz-Kreislauf-Stillstand nicht immer einfacher ist als bei Patienten, bei denen man eine Notfallnarkose durchgeführt hat (Wnent et al. 2015; Gellerfors et al. 2018).
Die Indikation zur Atemwegssicherung muss prähospital, also mit einem besonderen Augenmerk gestellt werden, hinsichtlich der Indikation notwendig sein und dann mit aller Stringenz erfolgen. Klare Indikationen für eine prähospitale Atemwegssicherung ergeben sich aus der S3-Leitlinie Polytrauma/Schwerverletztenbehandlung (Hilbert-Carius et al. 2017) im Falle einer Apnoe oder Hypoventilation, bei einer schweren Bewusstseinsstörung mit einem GCS < 9 (ohne rasch reversible Ursachen), bei einer respiratorischen Insuffizienz trotz Sauerstoffgabe und nach Ausschluss eines Pneumothorax und bei einer trauma-assoziierten Hypotension unter 90 mm Hg. In diesem Zusammenhang sei auf die S1-Leitlinie Prähospitales Atemwegsmanagement (AWMF) verwiesen (Timmermann et al. 2019).
A2.3 Vorgehen bei der Atemwegssicherung
Die S1 Leitlinie Atemwegsmanagement (Timmermann et al. 2019) und auch die S1 Leitlinie Notfallnarkose (Bernhard et al. 2015) geben ein klares Vorgehen vor. Auswertung eines deutschen Critical Incident Reporting Systems (CIRS)-Registern zeigen am Beispiel von 144 Atemwegszwischenfällen, dass diese letztendlich auf zehn Ursachen zurückgeführt werden können (Hohenstein et al. 2013):
• Intubationsindikationen lagen vor, wurden aber nicht berücksichtigt
• Intubationsindikatoren lagen nicht vor, trotzdem wurde eine Atemwegssicherung durchgeführt
• fehlerhafte Medikamentenwahl
• mangelnde manuelle Fertigkeiten
• alternatives Atemwegsmanagement nicht eingesetzt
• fehlerhaftes Handling vor und/oder nach der Atemwegssicherung
• defektes Equipment
• fehlendes Equipment
• sonstige Ursachen
• nicht zu beeinflussende Faktoren
Dabei gibt es ganz besonders interessante CIRS-Berichte (z. B. Tubus »falsch herum eingeführt« oder »Lesebrille vergessen, Stimmritze verschwommen gesehen«) (Hohenstein et al. 2013).
Die entsprechenden Kenntnisse aus dem CIRS-Register zeigen, dass prähospitale Atemwegszwischenfälle schwere Folgen für den Patienten haben können. Dabei ist es notwendig, diese soweit wie irgend möglich zu verhindern und ein besonderes Augenmerk auf die korrekte Indikationsstellung und die medikamentöse Narkoseeinleitung zu legen. Darüber hinaus sind Training und auch Erfahrung in der Atemwegssicherung ganz besondere Voraussetzungen, um in den komplexen Situationen der prähospitalen Notfallmedizin erfolgreich handeln zu können (Timmermann et al. 2019).
Wirklich wichtige Eckpfeiler des Vorgehens bei der Atemwegssicherung sind eine suffiziente Präoxygenierung bei spontanatmenden Patienten, die Oberkörperhochlagerung, die Nutzung eines Videolaryngoskopes, die Cuff-Druckmessung und eine 100 % Kapnografierate (Timmermann et al. 2019).
Für die Situation der prähospitalen Atemwegssicherung notwendigen Ausrüstungsgegenstände umfassen auch das alternative Atemwegsmanagement, die Kapnografie und eine Absaugung und sind regelhaft zum Einsatzort mitzunehmen. Ein typischer Pitfall ist, wenn im Rahmen der Atemwegssicherung mittels endotrachealer Intubation diese misslingt und dann nicht auf alternative Methoden zur Atemwegssicherung zurückgegriffen werden kann, da sich die Ausrüstung im Fahrzeug auf der anderen Seite des Fußballfeldes oder im Rettungshubschrauber befindet.
Die Videolaryngoskopie ist eine der führenden Maßnahmen zur Optimierung des Intubationserfolges in der prähospitalen Notfallmedizin. Neben den der S3-Leitlinie Polytraume/Schwerverletztenbehandlung (Hilbert-Carius et al. 2017) gibt auch die S1-Leitlinie prähospitaler Atemwegssicherung klare Empfehlungen zugunsten der Videolaryngoskopie ( 
Abb. A2.1a Abb. A2.1a: Einstellung der Stimmbandebene mittels eines Videolaryngoskopes und Identifizierung der laryngealen Strukturen. Abb. A2.1b: Durchtritt des Endotrachealtubus unter videolaryngoskopischer Sicht in die Trachea mit gleichzeitiger Verifikation der korrekten Tubuslage. Ein typischer Pitfall bei der Videolaryngoskopie ist, dass Studien zwar eine bessere Übersicht respektive Einstellbarkeit der Stimmbandebene aufzeigen, dass aber nicht unbedingt hiermit ein besserer Intubationserfolg assoziiert sein muss. Vor diesem Hintergrund sind beispielsweise indirekt einzusetzende Videolaryngoskope immer mit einem Führungsstab zu verwenden. Ebenfalls muss der Anwender sich bewusst sein, dass trotz guter Einstellbarkeit der Stimmbandebene nicht unmittelbar eine einfache Intubation der Stimmritze mit dem Endotrachealtubus erfolgen muss.
, b Abb. A2.1b: Durchtritt des Endotrachealtubus unter videolaryngoskopischer Sicht in die Trachea mit gleichzeitiger Verifikation der korrekten Tubuslage. Ein typischer Pitfall bei der Videolaryngoskopie ist, dass Studien zwar eine bessere Übersicht respektive Einstellbarkeit der Stimmbandebene aufzeigen, dass aber nicht unbedingt hiermit ein besserer Intubationserfolg assoziiert sein muss. Vor diesem Hintergrund sind beispielsweise indirekt einzusetzende Videolaryngoskope immer mit einem Führungsstab zu verwenden. Ebenfalls muss der Anwender sich bewusst sein, dass trotz guter Einstellbarkeit der Stimmbandebene nicht unmittelbar eine einfache Intubation der Stimmritze mit dem Endotrachealtubus erfolgen muss.
).
Читать дальше