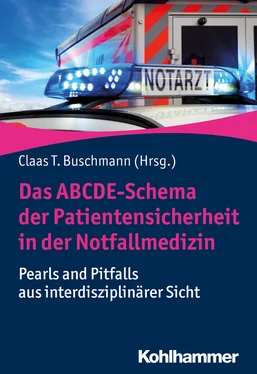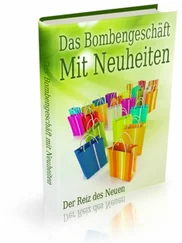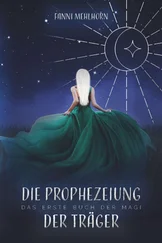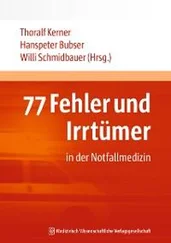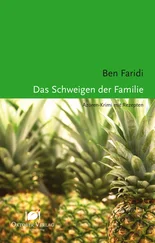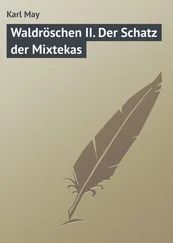Zukünftig wäre auch die anonymisierte Vernetzung rechtsmedizinischer Obduktionsergebnisse mit klinischen Datenbanken nicht nur denkbar, sondern wünschenswert. Zweifellos werden Studiennetzwerke als Perspektive in der notfallmedizinischen Forschung in naher Zukunft an Bedeutung gewinnen. Insgesamt weist die interdisziplinäre Kooperation zwischen Notfall- und Rechtsmedizin nicht nur ein hohes notfallmedizinisches Fortbildungspotenzial im jeweiligen Einzelfall auf, sondern auch ein erhebliches forscherisches Innovationspotenzial insbesondere bezüglich der retrospektiven Evaluation präklinischer Notfallmaßnahmen und Algorithmen. Aktuell bilden derartige Kooperationen in Deutschland allerdings (noch) die Ausnahme.
Liebe Leserinnen und Leser, die fachliche Beschäftigung mit den vielfältigen Facetten des menschlichen Todes ist nicht nur in der Rechtsmedizin, sondern auch in der Notfallmedizin von täglicher Relevanz. »Sterben« und »Tod« waren jedoch lange gesellschaftlich tabuisierte Themen und sind es z. T. heute noch. In der Rechtsmedizin, aber auch in der Notfallmedizin gehören diese Themen allerdings zur täglichen Realität. Ob das Leben nun eine Krankheit ist, die mit dem Tode endet, sei dahingestellt. Der Tod ist aber bekanntermaßen die gravierendste Diagnose, die einen Menschen treffen kann (und die uns alle treffen wird!). Jährlich sind > 850.000 Menschen in Deutschland betroffen, wovon sich ca. 450.000 Todesfälle außerhalb eines Krankenhauses ereignen und somit regelmäßig in den präklinischen Bereich der Notfallmedizin fallen. Miterlebte Todesfälle konfrontieren notfallmedizinisches Personal stets mit besonderen Herausforderungen medizinischer, einsatztaktischer und manchmal auch seelischer Art. Emotional belastende Begleitumstände (z. B. junges Lebensalter, Selbst-, Fremdtötung) können die Situation zusätzlich erschweren. Gelegentlich wird der Tod aus Sicht der Notfallmedizin auch als medizinische Niederlage erlebt, teilweise sogar als persönliches Versagen bewertet. Ein trotz notfallmedizinischer Behandlung verstorbener bzw. sterbender Patient bedeutet aber natürlich keinesfalls ein Versagen des Rettungsteams. Ein kritisches Hinterfragen eines solchen Einsatzes sollte aber stets erfolgen. Wir sind weder »Leichenfledderer« auf der einen Seite noch »Krankenwagenfahrer« auf der anderen Seite, sondern Profis in unserem jeweiligen Bereich – und dabei gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir können viel voneinander lernen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur viel Spaß beim Lesen, sondern vor allem viel Erfolg bei der Umsetzung der Tipps aus dem Buch.
Dr. Claas Buschmann
Berlin, im September 2021
A Airway
A1 Supra-/Extraglottische Atemwegssicherung
Markus Stuhr und Thoralf Kerner
A1.1 Atemwegssicherung in der Präklinik
Die Maßnahmen zur Atemwegssicherung nehmen unter den für die präklinische Notfallmedizin notwendigen Fähigkeiten eine zentrale Rolle ein. Nur bei einem freien und gesicherten Atemweg ist eine Oxygenierung der Organe und Gewebe möglich. Neben dem Goldstandard für die präklinische Atemwegssicherung – der endotrachealen Intubation – existiert eine Reihe von Möglichkeiten, trotz misslungener oder unmöglicher endotrachealer Intubation eine Ventilation und Oxygenierung zu etablieren. Unter dem Begriff supra- und extraglottische Atemwegshilfen werden nicht-invasive sowie nicht-chirurgische Möglichkeiten zusammengefasst, die Gegenstand dieses Kapitels sind. Auch die Anwendung supra- und extraglottischer Atemwegshilfen setzt spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten im Hinblick auf eine sichere Patientenversorgung voraus. Neben einigen wesentlichen Grundlagen zu den einzelnen Atemwegshilfen sollen insbesondere typische Fehlerquellen und dazu passende Lösungsvorschläge im Vordergrund stehen.
A1.2 Supra-/Extraglottische Atemwegshilfen
Eine durchgängige und einheitlich verwendete Definition der Begriffe »supraglottisch« und »extraglottisch« findet sich in der medizinisch-wissenschaftlichen Literatur nicht. In einer neueren Übersichtsarbeit zur »Neubewertung extraglottischer Atemwegshilfsmittel (unterteilt in »laryngopharyngeale« und »supraglottische« Atemwegshilfen sowie »ösophageale Verschlusstuben«) in der Notfallmedizin« (Timmermann und Russo 2017, S. 145) haben die Autoren die Begrifflichkeiten sehr anschaulich entsprechend ihrer Position in der anatomischen Ebene in »Gesichtsmaske«, »Extraglottische Atemwege« und »Endotrachealtubus« unterteilt. Kernelement aller extra- und supraglottischen Hilfsmittel ist, dass das distale Ende oberhalb der Stimmritze liegt (Arntz und Breckwoldt 2016, S. 107).
Bereits aus dieser Einteilung ergeben sich die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren wie z. B. der nicht vollständige Aspirationsschutz bei allen extraglottischen Atemwegshilfen.
Wenngleich die Anwendung extraglottischer Atemwegshilfen unter technischen Gesichtspunkten weniger anspruchsvoll ist als die Durchführung einer endotrachealen Intubation, ist auch dafür eine strukturierte Ausbildung inkl. Durchührung der Technik am Patienten notwendig. In der kürzlich publizierten S1-Leitlinie zum prähospitalen Atemwegsmanagement wurden Empfehlungen hinsichtlich der notwendigen Erfahrung vor Anwendung von extraglottischen Atemwegshilfen in der prähospitalen Notfallsituation formuliert:
»Die Anwendung von mindestens 45 Einlagen extraglottischer Atemwege soll an Patienten und unter kontrollierten Bedingungen und Anleitung zum Erlernen der Technik erfolgen. Die Anwendung soll mindestens dreimal jährlich wiederholt werden. Ein Training am Übungsphantom allein ist nicht ausreichend« (Timmermann et al. 2019, S. 29).
Unterschiede zwischen den supraglottischen Atemwegshilfen (Larynxmasken) und den ösophagealen Verschlusstuben (Larynxtubus) ergeben sich durch die Art und Weise des Cuffs und der Ventilationsöffnung. Während der Cuff der supraglottischen Atemwegshilfen am laryngealen Eingang anliegt und die Ventilation durch eine zentrale Öffnung erfolgt, besitzen die ösophagealen Verschlusstuben (Larynxtubus) eine Ventilationsöffnung zwischen zwei Cuffs im pharyngealen und ösphagealen Bereich.
Hinsichtlich der Wertigkeit der einzelnen Typen an extraglottischen Atemwegshilfen existiert inzwischen eine Vielzahl an wissenschaftlichen Studien. Sie alle eint das Problem der kaum gegebenen Vergleichbarkeit aufgrund der verschiedenen strukturellen Gegebenheiten in der Präklinik, der Vielzahl verschiedener Erkrankungen und der Unterschiede in der Qualifikation und Erfahrung des Personsals (Timmermann et al. 2019, S. 8). Mit Blick auf den Endpunkt aller Maßnahmen, die potenziell lebensrettende Oxygenierung des Patienten, ist letztlich von Bedeutung, dass die gewählte Atemwegshilfe im Rahmen alltäglicher Anwendung auch zum Erfolg führt. Auch hierzu findet sich in der bereits zitierten Leitlinie eine klare Empfehlung:
»Prähospital soll diejenige extraglottische Atemwegshilfe vorgehalten werden, die mehrheitlich in einem Rettungsdienstbereich in der Klinik zum Training Anwendung findet. Die Entscheidung, welche extraglottische Atemwegshilfe verwendet wird, soll von den örtlichen Gegebenheiten und Trainingsmöglichkeiten am Patienten in elektiven Situationen abhängig gemacht werden. Hierzu ist eine engmaschige Kommunikation zwischen den Organisationsverantwortlichen des Rettungsdienstes und denen der Anästhesieabteilungen der ausbildenden Kliniken unabdingbar« (Timmermann et al. 2019, S. 28/29).
Von wesentlicher Bedeutung nach jeder Form einer invasiven Atemwegssicherung ist die anschließend obligat durchzuführende Kapnografie (Timmermann et al. 2019, S. 34).
Zu den elementaren Grundfertigkeiten des gesamten in der Notfallmedizin eingesetzten Personals gehört die Beatmung über eine Gesichtsmaske ( 
Abb. A.1.1 Abb. A1.1: Gesichtsmaske (Links), Oropharyngeal- (»Guedel«, Mitte) und Nasopharyngeal-Tubus (»Wendl«, Rechts)
). Sie ermöglicht mit wenigen Handgriffen eine Beatmung und Oxygenierung des Notfallpatienten. Obwohl der technische Aufwand gering ist und nur eine Gesichtsmaske und ein Beatmungsbeutel benötigt werden, erfordert auch dieses Verfahren für eine sichere Anwendung regelmäßiges Training (Stuhr 2019, S. 38–39). Durch den sog. C-Griff erfolgt die Fixierung der Maske, sodass Daumen und Zeigefinger der linken Hand am Körper der Maske, der Mittel- und Ringfinger der linken Hand am unteren Rand des Unterkiefers positioniert sind (Stuhr 2019, S. 39).
Читать дальше